In Zeiten, in denen Datenmengen rasant wachsen und wissenschaftliche Projekte immer größere Anforderungen an Speicher- und Zugriffszeiten stellen, gewinnt EOS Open Storage als moderne Speicherlösung zunehmend an Bedeutung. EOS ist eine maßgeschneiderte Plattform, die bei CERN entwickelt wurde, um den enormen Speicherbedarf von physikalischen Experimenten, insbesondere der Daten, die am Large Hadron Collider (LHC) generiert werden, zu erfüllen. Durch die Unterstützung von mehr als 930 Petabyte an Datenvolumen, die täglich von tausenden Usern und Analyseprozessen verarbeitet werden, demonstriert EOS seine robuste Performance und hohe Zuverlässigkeit. Dabei ist das System nicht nur für CERN selbst, sondern auch für wissenschaftliche Kooperationspartner rund um den Globus von großer Relevanz. Die Kernfunktion von EOS liegt in der Bereitstellung eines flexiblen Speichersystems, das interaktive und batchorientierte Zugriffe gleichermaßen unterstützt.
Dies ist insbesondere für die aufwendige Analyse physikalischer Daten essenziell, bei denen schnelle Reaktionszeiten und gleichzeitig hohe Datendurchsatzraten gefragt sind. EOS wurde so konzipiert, dass es eine große Anzahl von Clients unterstützt, die auf das System mit zufälligen Remote-I/O-Mustern zugreifen. Die Fähigkeit, verschiedenste Zugriffsprotokolle wie WebDAV, CIFS, FUSE, XRootD oder GRPC einzubinden, erhöht die Adaptabilität des Systems und erleichtert die Integration in heterogene Umgebungen. Die Architektur von EOS teilt sich in Client- und Serverkomponenten auf. Auf der Client-Seite stellen Kommandozeileninterfaces und gemountete Dateisysteme die Verbindung zur Speicherung bereit.
Diese ermöglichen es Nutzern und Anwendungen, Daten effizient zu lesen und zu schreiben, ohne sich um die komplexe Infrastruktur dahinter kümmern zu müssen. Auf der Serverseite übernimmt ein differenziertes System die Trennung von Metadaten- und Datenspeicherung. Die Metadatenverwaltung erfolgt über eine spezialisierte Key-Value-Datenbank namens QuarkDB, die auf RocksDB aufbaut. Dies garantiert schnelle und konsistente Zugriffsmöglichkeiten auf Dateiinformationen und Verzeichnisstrukturen. Die eigentlichen Daten werden auf leistungsfähigen Dateisystemen wie XFS abgelegt, wobei sowohl klassische Festplatten als auch SSDs Verwendung finden.
Zudem kann EOS auf virtualisierte Backends oder verteilte Dateisysteme wie Lustre oder CephFS zurückgreifen, um den Speicherbedarf flexibel zu skalieren und zu optimieren. Das Sicherheitskonzept von EOS ist umfassend gestaltet, um den Schutz sensibler wissenschaftlicher Daten sicherzustellen. Die Speicherlösung unterstützt verschiedene Authentifizierungsmechanismen, darunter Kerberos (KRB5), X509-Zertifikate, OIDC (OpenID Connect), sogenannte Shared Secrets sowie JSON Web Tokens (JWT). Darüber hinaus wird eine proprietäre Token-Autorisierung angeboten, die es ermöglicht, granulare Berechtigungsmodelle umzusetzen und den Zugriff auf Daten streng zu kontrollieren. Dies ist ein entscheidender Faktor, um den gesetzlichen und organisatorischen Anforderungen an die Datensicherheit und Nachvollziehbarkeit gerecht zu werden.
Neben der reinen Datenspeicherung bietet EOS auch Funktionen zur Synchronisation und gemeinsamen Nutzung von Dateien. Die sogenannte Sync&Share-Funktionalität ist eng mit CERNBox verbunden, dem cloudartigen Frontend-Service von CERN, der es Forschern ermöglicht, Daten einfach zu teilen und gemeinsam zu bearbeiten. Diese Integration macht EOS zu einem ganzheitlichen Ökosystem, das nicht nur Speicherplatz bereitstellt, sondern auch die Zusammenarbeit und Datenverwaltung innerhalb von Forschungsgruppen fördert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kombination von EOS mit Tape Storage über das CTA (Cern Tape Archive). Die langfristige Archivierung großer Datenmengen, die oft über Jahre oder Jahrzehnte aufbewahrt werden müssen, erfolgt auf magnetischen Bändern.
EOS sorgt dabei für eine effiziente Schnittstelle zwischen den schnellen, online verfügbaren Speicherebenen und der langfristigen Datensicherung auf Tape-Medien. Diese hybride Speicherlösung sichert eine Balance zwischen Zugriffsgeschwindigkeit und ökonomischer Speicherung großer Datenmengen. Die Community rund um EOS ist aktiv und vielfältig. Neben den Hauptentwicklern bei CERN gibt es zahlreiche Mitwirkende aus verschiedenen Ländern und Einrichtungen, die zum Fortschritt und zur Verbreitung der Technologie beitragen. Regelmäßig organisierte Workshops, wie der kommende 9.
EOS Workshop im März 2025, bieten ein Forum für den Austausch zwischen Entwicklerteams, Anwendern und Site-Betreibern. Hier werden neue Entwicklungen, Einsatzmöglichkeiten und Best Practices diskutiert, was zur kontinuierlichen Optimierung und Weiterentwicklung von EOS beiträgt. CERN stellt umfangreiche Ressourcen zur Verfügung, um Anwendern und Administratoren eine reibungslose Nutzung von EOS zu ermöglichen. Dokumentationen, Präsentationen, Veröffentlichungen und Release Notes liefern detaillierte Informationen zur Systemarchitektur, Installation, Konfiguration und Nutzung. Open Source Komponenten und die Verfügbarkeit des Codes auf Plattformen wie GitHub und GitLab fördern Transparenz und Kollaboration.
Gleichzeitig ermöglicht ein aktives Support-Team die schnelle Reaktion bei technischen Fragen oder Problemen. Die technologische Basis von EOS umfasst moderne datenorientierte Softwaretechniken. Die native Kommunikation erfolgt über das XRootD-Protokoll, das seit vielen Jahren in der hohen Energieforschung bewährt ist. Die Speicherserver sind modular aufgebaut und skalieren horizontal, was bedeutet, dass bei wachsendem Speicherbedarf problemlos neue Server hinzugefügt werden können. In Kombination mit einer robusten Metadatenbank und vielseitigen Speicher-Backends ergibt sich ein sehr leistungsfähiges und zuverlässiges System.
Die beeindruckenden Zahlen von EOS bei CERN sprechen für sich: Über 930 Petabyte Speicherkapazität, mehr als 70.000 Festplatten und rund 30.000 Clients, die gleichzeitig auf das System zugreifen. Die Gesamtzahl der gespeicherten Dateien übersteigt die acht Milliarden Marke. Diese Größenordnung verdeutlicht die Leistungsfähigkeit und die Rolle von EOS als Rückgrat der Dateninfrastruktur bei CERN.
EOS ist jedoch keine Lösung, die nur für Hochenergiephysik geeignet ist. Die Flexibilität, Skalierbarkeit und die vielseitige Protokollunterstützung machen die Plattform auch für andere datenintensive Disziplinen attraktiv, etwa für Bioinformatik, Klimaforschung oder große IT-Infrastrukturen, die großen Wert auf schnelle, verlässliche und sichere Datenspeicherung legen. Die Teilnahme von internationalen Partnern unterstreicht, dass EOS als Open Storage Framework nicht nur eine proprietäre Lösung bleibt, sondern sich als Standard in Forschungsnetzwerken etabliert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass EOS Open Storage eine durchdachte, hochskalierbare und sichere Speicherumgebung für verteilte und datenintensive Anwendungen bietet. Die Kombination aus technischer Exzellenz, offener Architektur und aktiver Community macht EOS zu einer wegweisenden Speicherlösung, die weit über CERN hinaus Wirkung zeigt.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung und der praktische Einsatz in realen, herausfordernden Forschungsprojekten sichern die Zukunftsfähigkeit dieser Technologie, mit der große Datenmengen effizient und sicher verwaltet werden können.
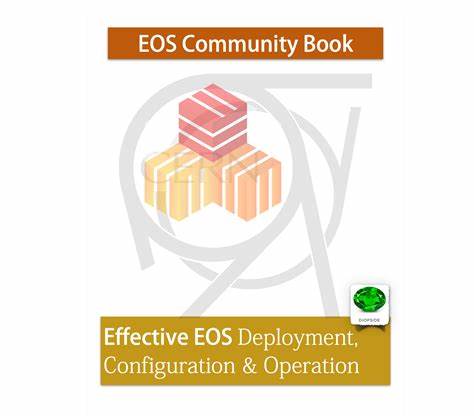



![Quantum Expert Insight: Peter Shor [video]](/images/151C41ED-6972-4913-9F3C-5DA27872DCB4)

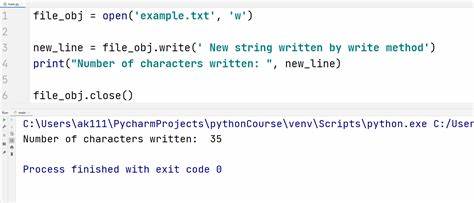
![Long-lasting HIV prevention [vaccine] shot headed toward approval](/images/114779DA-184C-4E60-873E-0DB06F8B36D1)

