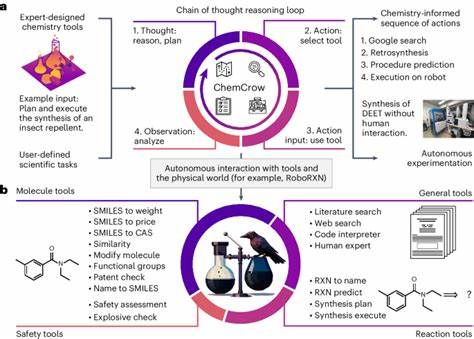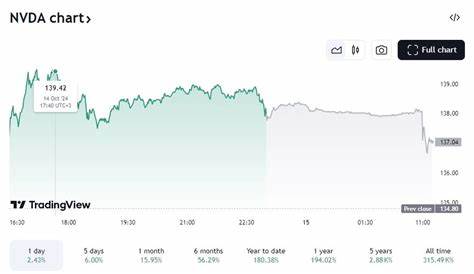Richard Foreman gilt als eine der bedeutendsten Figuren im Bereich des experimentellen Theaters und als einer der rebellischsten Vertreter der amerikanischen Avantgarde. Seine Theaterarbeiten haben zwischen den späten 1960er Jahren und den frühen 2010er Jahren das Verständnis von Theater und Performance radikal verändert. Foreman war nicht nur Dramatiker, sondern auch Regisseur, Bühnenbildner und Klangkünstler, der sein Gesamtkunstwerk mit einem unverkennbaren Stil und einer einzigartigen Philosophie schuf. Seine Werke sind mehr als nur Aufführungen – sie sind lebendige Kunstwerke, in denen der Fluss der Gegenwart, das Erleben des Moments, im Mittelpunkt steht.Geboren 1937 und aufgewachsen in einer wohlhabenden Vorstadt von New York, war Foreman schon früh auf der Suche nach künstlerischer Tiefe und intellektueller Herausforderung.
Die konventionelle Welt der Vorstadt bot ihm wenig Inspiration, weshalb er oft nach Manhattan pendelte, um Theaterproduktionen zu besuchen. An der Brown University zeigte er sein schauspielerisches Talent, absolvierte anschließend ein Masterstudium für Dramatik an der Yale School of Drama und tauchte bald ins pulsierende, experimentelle Kunstmilieu von New York ein. Dort, in den 1960er Jahren, begegnete er Künstlern und Filmemachern, die Konventionen brachen und eine neue Sprache der Kunst suchten.Foreman war ein entschiedener Kritiker des Realismus im Theater. Er sah ihn als einschränkend an, als eine Rückentwicklung, die das Medium Theater in eine falsche Nachahmung des Alltags zwang.
Stattdessen orientierte er sich an der Idee von Gertrude Stein, dass sich Kunst im „kontinuierlichen Jetzt“ entfalten sollte. Für Foreman bedeutete das, die linear erzählte Geschichte, mit ihren klar definierten Anfängen, Mitteln und Enden, aufzugeben und stattdessen den Zustand des Seins, der Wahrnehmung und des Bewusstseins in den Mittelpunkt zu stellen. Er wollte die Flüchtigkeit und das chaotische Potenzial des Augenblicks einfangen und nicht festhalten.Die Inszenierungen von Foreman lassen sich nicht als klassische Theaterstücke beschreiben. Seine Arbeitsweise war geprägt von einem flexiblen Skript, das sich während der oft monatelangen Proben immer wieder veränderte.
Texte wurden verteilt, neu arrangiert und den unterschiedlichen Darstellern anvertraut, wobei auch die Bühnenbilder, Requisiten und Kostüme täglich neu gestaltet wurden. Dieses dynamische Vorgehen machte jede Aufführung zu einem einzigartigen Moment, der sich nicht wiederholen ließ. Foreman verstand seine Arbeiten als „Resonanzmaschinen“, die von den vielschichtigen Verbindungen und Überlagerungen zwischen Text, Bewegung, Bild und Ton lebten.Visuell hat sich Foremans Stil im Laufe der Jahre stark gewandelt. Anfangs dominierten surreale, fast verträumt wirkende Szenen mit ungewöhnlichen Gegenständen und scheinbar zusammenhanglosen Figuren, die mit assoziativen oder fragmentarischen Sätzen auftraten.
Später wurde sein Bühnenbild dunkler, sogar bedrohlich, mit einer Fülle von Requisiten und visuellen Störungen, die das Publikum herausforderten, genauer hinzusehen und die Oberfläche zu durchdringen. Seine Darsteller befanden sich häufig in ständiger Bewegung, voller Körpersprache, begleitet von Klängen und Sound-Loops, die Foreman selbst während der Aufführung live bediente.Foremans Theater erfahrenen Zuschauer, die sich auf seine Welt einlassen, begegnen Figuren, die nicht im herkömmlichen Sinn handeln oder Geschichten erzählen. Stattdessen entfalten sich Dialoge, die an philosophische Meditationen erinnern und in ihrer Mischung aus Mystik, Komik und Rätselhaftigkeit den Geist herausfordern. Seine Themen kreisen häufig um das Sein, um Wiederholung und Suche, um das Verfehlen von Antworten und die Umarmung des Ungewissen.
Nach der Aufführung bleiben viele Zuschauer mit einem Gefühl von Verwirrung und Überschwang zurück, unfähig, klar zu formulieren, was sie gesehen haben, doch tief beeindruckt von der Erfahrung.Der Kubus einer Bühne bei Foreman war weniger Raum für Illusion als vielmehr eine Art Labor für Bewusstsein und Wahrnehmung. Oft benutzte er Plexiglaswände, die einerseits den Zuschauerraum vom Bühnengeschehen trennten, andererseits aber auch als Spiegel dienten und so das Publikum dazu zwang, sich selbst zu betrachten und seine eigene Rolle in der Wahrnehmung der Kunst zu reflektieren. Plötzliche akustische oder visuelle Störungen, abrupte Lichtwechsel oder unerwartete Actionszenen sorgten zusätzlich dafür, dass das Publikum nicht in eine passive Rezeption verfiel, sondern permanent aufmerksam blieb.Foremans Beziehung zu seinen Schauspielern war ebenfalls ungewöhnlich.
Er betrachtete sie eher als Instrumente oder Modelle denn als klassische Darsteller, deren Aufgabe es ist, Emotionen glaubhaft zu verkörpern. Inspiriert von dem französischen Filmemacher Robert Bresson, forderte er seine Akteure auf, ihre Gebärden und Texte so oft zu wiederholen, bis jeder Anflug von Theatralik verschwand und eine direkte, unverfälschte Übertragung des Textes entstand. Diese intensiven, technisch anspruchsvollen Proben sorgten dafür, dass seine Stücke auch physisch, mit kleinen Gesten und winzigen Veränderungen in Bewegung und Haltung, gestaltet wurden. Solche Details, so unbedeutend sie erscheinen mochten, waren Foreman oft entscheidend wichtig und konnten über die Bedeutung einer ganzen Szene entscheiden.Trotz seiner rigorosen und manchmal ungewöhnlichen Methoden war Foremans Arbeit von einer fundamentalen Liebe zur Kunst und zu einem fortwährenden Schaffensprozess geprägt.
Er wollte keine fertigen Antworten geben, sondern ein offenes Feld schaffen, auf dem Fragen gestellt und erlebt werden konnten. Sein Schaffen wurde zu einer Lebensweise, in der kreatives Denken und spontane Eingebungen Hand in Hand gingen. Selbst kurz vor seinem Tod war Foreman weiterhin kreativ aktiv und plante immer wieder neue Werke, getrieben von einem unersättlichen Hunger nach „wahren Aussagen über das Existieren“.Foremans Einfluss auf das Theater und die Kunstwelt ist groß. Obwohl seine Produktionen oft eine Herausforderung für Publikum und Kritiker darstellten und viele Zuschauer das Theater während seiner Aufführungen verließen, gilt er als Pionier eines Theaters, das sich vom Mainstream der Unterhaltung und der Realismus-Tradition abhebt.
Die Ontological-Hysteric Theater Company, die er gründete, wurde zum Zentrum einer internationalen Avantgarde-Bewegung, die begabte Künstler aller Disziplinen zusammenbrachte.Ein weiterer bedeutender Aspekt von Foremans Erbe ist seine radikale Offenheit und Bereitschaft, sein Werk der Öffentlichkeit und anderen Künstlern zugänglich zu machen. Bereits Ende der 1990er Jahre veröffentlichte er eine große Anzahl von Texten und Materialien auf der Website des Ontological-Hysteric Theaters mit der ausdrücklichen Einladung, seine Texte für neue Projekte zu verwenden, zu bearbeiten oder weiterzuentwickeln. Dies unterstreicht seinen Glauben an Kunst als lebendigen Prozess, der im ständigen Wandel begriffen ist und nicht durch Eigentumsansprüche oder feste Traditionen eingeschränkt werden darf.Angesichts der heutigen kulturellen Landschaft, in der viele Institutionen und Künstler mit der Herausforderung kämpfen, Neues zu schaffen und alte Formen zu hinterfragen, zeigt Foremans Arbeit Wege auf, wie Avantgarde erhalten und weiterentwickelt werden kann.