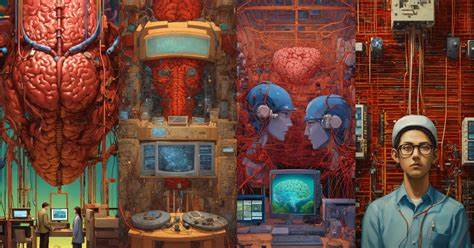In der heutigen urbanen Mobilitätsplanung gewinnt die präzise Darstellung von Wegezeiten und Zugangsmöglichkeiten immer mehr an Bedeutung. Vor allem die Berücksichtigung von Höhenunterschieden in Stadtlandschaften ist ein immer stärker beachteter Faktor, der Einfluss darauf hat, wie Menschen ihre alltäglichen Wege planen und zurücklegen. Städte mit hügeligem oder unebenem Gelände, wie Seattle, stellen hierbei eine besondere Herausforderung dar, da herkömmliche Zugangsmodelle häufig von einer konstanten Gehgeschwindigkeit ausgehen und damit die Realität in solchen Umgebungen verzerren. Die Entwicklung und Einführung neuer Modelle, die Elevation berücksichtigen, markiert einen wichtigen Fortschritt, um Mobilitätsdaten und damit verbundene Planungen realitätsnäher abzubilden. Traditionelle Ansätze in der Zugangsanalyse basieren in der Regel auf der Annahme einer einheitlichen Gehgeschwindigkeit, unabhängig von Steigungen oder Gefälle entlang des Weges.
Dies führt zu einer systematischen Überschätzung des Zugangs in hügeligen Gebieten, da die tatsächliche Zeit für das Zurücklegen einer Strecke auf steilen Anstiegen deutlich höher ausfällt. Solch eine Vereinfachung wurde insbesondere in topografisch herausfordernden Städten kritisiert, da sie wichtige regionale Unterschiede verfälscht und somit unter Umständen falsche Schlüsse über Erreichbarkeit und Mobilitätsoptionen zulässt. Die Einbeziehung von Höhendaten in die Analyseumgebung erfordert zunächst eine verlässliche Quelle für Geländeinformationen. In aktuellen Projekten werden hierzu häufig Terrain-Daten aus spezialisierten Tilesets wie Mapzen’s Terrain Tiles verwendet, die eine ausreichend feine Auflösung bieten, um Veränderungen über Distanzen von etwa 30 Metern zu erfassen. Diese Daten werden mit Straßendaten, beispielsweise aus OpenStreetMap, kombiniert, sodass die Steigung jedes einzelnen Straßen- oder Wegsegments berechnet und in die Zugangsberechnung eingeflossen werden kann.
Trotz gewisser Unschärfen, die beispielsweise durch kleinere, nicht erfasste Geländeunebenheiten oder potenziell fehlerhafte Zugangsdaten entstehen können, ermöglicht dieses Verfahren eine deutlich realistischere Abschätzung der zeitlichen Erreichbarkeit. Ein bewährtes Instrument zur Anpassung der durchschnittlichen Gehgeschwindigkeit an die Steigung ist Tobler’s Hiking Function. Diese empirisch entwickelte Funktion modelliert die Veränderung der Gehgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Steigung und gewährleistet, dass auf flachem Terrain die Standardgeschwindigkeit von etwa 1,4 Metern pro Sekunde (rund 5 km/h) angenommen wird. Interessanterweise zeigt das Modell, dass Geschwindigkeiten bei leichtem Gefälle bis zu 6 km/h steigen können, während sie bei Steigungen merklich absinken. In urbanen Kontexten, auch wenn Tobler’s Funktion ursprünglich für Wanderungen in natürlichem Gelände konzipiert wurde, bietet sie eine einfache und nachvollziehbare Grundlage für die Anpassung der Gehgeschwindigkeiten.
Die Einführung einer Gehgeschwindigkeit, die von der Steigung beeinflusst wird, hat direkte Auswirkungen auf die Zahl der innerhalb eines definierten Zeitfensters zu erreichenden Ziele. Betrachtet man eine Zeitspanne von etwa 30 Minuten, so zeigt sich beispielsweise für Seattle ein Rückgang der erreichbaren Zielpaare um fast 20 Prozent. Dies illustriert, dass das Gelände effektiv den Aktionsradius eines durchschnittlichen Fußgängers einschränkt – vor allem in Gebieten mit signifikanten Höhenunterschieden. Speziell Sektoren, die in Tälern gelegen sind und an steile Klippen angrenzen, zeigen die stärksten Einbußen in der Erreichbarkeit. Solche topografischen Extrembereiche offenbaren, wie entscheidend es ist, die Erhebung in mobilitätsrelevanten Berechnungen zu berücksichtigen, denn dort unterschätzt die flache Modellannahme erheblich den Zeitaufwand für Fußwege.
Neben der direkten Auswirkung auf Fußwege beeinflusst die Einbeziehung von Elevation auch die Einschätzung der Erreichbarkeit mittels öffentlicher Verkehrsmittel. Ein längerer Fußweg zu einer Haltestelle kann die Gesamtzeit von Pendlerwegen erhöhen und somit die Attraktivität bestimmter Transitoptionen mindern. Andererseits können Busse und Bahnen dabei helfen, große Höhenunterschiede schneller zu überwinden, was den Nachteil des verlangsamten Gehens teilweise ausgleichen kann. Analysen, die zudem zeitabhängige Fahrtmöglichkeiten berücksichtigen, zeigen, dass der Rückgang der insgesamt erreichbaren Ziele mit Transit geringer ausfällt als ohne: etwa 15 Prozent gegenüber knapp 20 Prozent bei reinem Fußverkehr. Dies unterstreicht die Bedeutung eines integrierten Betrachtungsansatzes, der Fußwege und Transitnutzung gemeinsam analysiert.
Darüber hinaus deuten statistische Untersuchungen und Korrelationsanalysen darauf hin, dass die Auswirkungen der Geländeberücksichtigung auf einzelne Stadtsektoren relativ gut durch einen linearen Faktor approximiert werden können. Die starke Korrelation zwischen den Ergebnissen der flachen und der höhenangepassten Modelle ermöglicht es, die Veränderung der Erreichbarkeit durch Multiplikation mit einem Reduktionsfaktor abzuschätzen. Diese Erkenntnis ist besonders nützlich für Planer, die unter pragmatischen Gesichtspunkten eine schnelle Einschätzung der Höhenauswirkungen wünschen, ohne aufwendig neue Modelle durchzurechnen. Die modellgestützte Anpassung der Gehgeschwindigkeit wirkt sich zudem unterschiedlich auf einzelne Buslinien und Routen aus. Routen, welche starke Höhenprofile aufweisen oder besonders auf steile Gebiete ausgelegt sind, gewinnen unter Berücksichtigung der Höhendifferenzen an Wichtigkeit, da sie den Zugang zu sonst relativ schwer erreichbaren Bereichen verbessern.
Während die Reihenfolge der Routen hinsichtlich ihres Beitrags zur Erreichbarkeit sich in der Regel nur geringfügig ändert, können einzelne Streckenabschnitte deutlich an Bedeutung gewinnen. Dadurch lässt sich die Wertigkeit bestimmter Angebote im öffentlichen Nahverkehr besser herausarbeiten, was zu fundierteren und gerechteren Planungsentscheidungen führen kann. Die Verbesserung von Zugangsanalyse-Software durch Höhenberücksichtigung ist also ein Schritt in Richtung realitätsnähere Mobilitätsplanung. Die Grenzwerte liegen dabei nicht nur in den durchschnittlichen Auswirkungen – die sich auf den ersten Blick als moderate Einbußen im Erreichbarkeitsindex darstellen – sondern zeigen sich vor allem an den Extremen, den Bereichen mit außergewöhnlich steilen oder unzugänglichen Wegen. Hier können neue Modelle und Methoden, die individuelle Mobilitätsbedürfnisse oder spezielle Nutzungsgruppen, etwa Menschen mit eingeschränkter Mobilität, einbeziehen, erhebliche Vorteile bringen.
Es besteht weiterhin Perspektive, dass für längere Zeitbudgets oder für differenzierte Nutzerprofile die Annahme einer linearen Korrelation zwischen flacher und höhenangepasster Erreichbarkeit nicht mehr ausreicht. In solchen Szenarien könnten komplexere Modelle notwendig werden, die eine feinere Differenzierung der Zugangszeiten und Pfade ermöglichen. Dennoch bestätigen Studien, dass für typische urbane Mobilitätsanalysen der mittelfristigen Dauer die Zugangsmodelle ohne Höhenanpassung grundsätzlich brauchbare Ergebnisse liefern und als Basis für viele Planungsprozesse akzeptiert werden können. Die Kombination von digitalen Terrain-Daten, offenen Kartendaten und einfachen, aber bewährten mathematischen Modellen führt somit zu signifikanten Fortschritten in der präzisen Bewertung von Zugänglichkeit in Städten mit herausfordernder Topografie. Sie stärkt das Vertrauen in Ergebnisse von Zugangsanalyse-Tools und bietet eine solide Grundlage für zukünftige, differenziertere Analysen, die auch individuelle Bedürfnisse und unterschiedliche Fortbewegungsarten einbeziehen werden.
Insgesamt wird durch diese Entwicklung klarer, wie tiefgehend der Einfluss der physischen Umgebung auf urbane Mobilität ist und wie wichtig es ist, diesen Faktor bei der Gestaltung nachhaltiger, inklusiver und nutzerorientierter Verkehrssysteme zu integrieren.