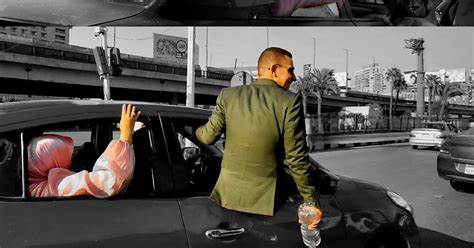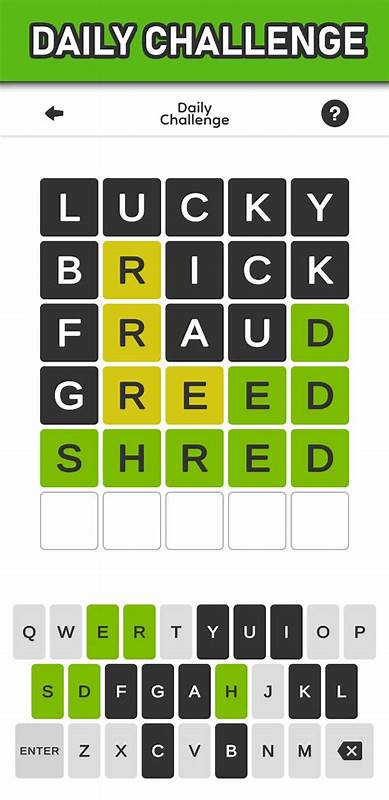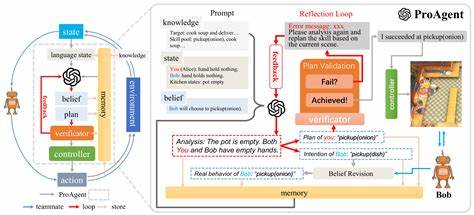Reisen gilt heute als eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten weltweit. Wir planen unsere nächsten Urlaube mit großer Vorfreude, posten Fotos von exotischen Orten in sozialen Medien und erzählen uns stolz, wie sehr uns das Reisen bereichert hat. Doch hinter dieser scheinbar positiven Erfahrung verbirgt sich eine oft unterschätzte Realität: Reisen verändert uns nicht so sehr, wie wir glauben, und es kann uns sogar in schlechterer Version unserer selbst zurücklassen. Agnes Callard, Philosophin an der University of Chicago, widmet sich dieser These in ihrem Essay „The Case Against Travel“ aus dem Jahr 2023 und liefert eine tiefgreifende Kritik am Tourismus und modernen Reiseverhalten. Der weitverbreitete Satz „Ich liebe es zu reisen“ ist, so Callard, einer der uninformativsten Sätze überhaupt.
Er verrät wenig über den einzelnen Menschen, denn fast jeder mag es zu reisen. Dennoch wird das Reisen von Vielen als persönliche Leistung oder sogar als moralischer Wert erachtet. Doch bereits historische Denker wie G.K. Chesterton, Ralph Waldo Emerson, Immanuel Kant oder Fernando Pessoa standen dem Reisen skeptisch gegenüber.
Pessoa etwa bekundete eine abgrundtiefe Abneigung gegenüber neuen Lebensweisen und fremden Orten und verachtete das Reisen als Notwendigkeit für Menschen mit mangelnder Vorstellungskraft. Diese Haltung wirkt heute beinahe provokativ, doch ein genauer Blick offenbart valide Argumente, denen man Beachtung schenken sollte. Ein zentraler Kritikpunkt besteht darin, dass das Reisen uns nicht authentisch mit anderen Kulturen oder Menschen verbindet, sondern uns vielmehr von ihnen entfremdet. Reisen versetzt uns in eine Position der Distanz, aus der wir die bereisten Orte und ihre Bewohner als bloße Objekte betrachten. Tourismus wird so oft zur Anhäufung von Erfahrungen, Fotos und Souvenirs, die als Beweis dafür dienen sollen, dass wir etwas erlebt haben – doch tatsächlich bleiben dabei die tiefgründigen Erlebnisse aus.
Die Motivation hinter dem Tourismus bezeichnet Callard als das Streben nach Veränderung, einem Wechsel der Umgebung und dessen Eindrücken. Das Problem daran ist, dass diese Veränderung meist oberflächlich bleibt. Man besucht die bekannten Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den Louvre oder die Mona Lisa, oftmals nur, um sagen zu können „Ich war da“, ohne wirklich in die Kultur oder Bedeutung einzutauchen. Der Akt des Sehens reduziert sich häufig auf das bloße Abhaken von Sehenswürdigkeiten – um dann schnell zum nächsten Must-See weiterzuziehen. Die Touristenhaltung ist geprägt von einer inneren Zerrissenheit: Sie wollen sich einerseits anpassen und das tun, „was man dort macht“, andererseits vermeiden sie genau das, was ihnen ursprünglich wichtig wäre.
Darüber hinaus trägt der Tourismus häufig Veränderungen an Orten herbei, die nicht zur Kultur oder dem Alltag der Einheimischen gehören. Touristische Einrichtungen, Attraktionen und Programmpunkte werden gezielt auf die Erwartungen und Bedürfnisse der Reisenden zugeschnitten, was eine Anpassung oder gar Verzerrung kultureller Eigenheiten bedeutet. Ein Beispiel dafür schildert Callard anhand eines Besuchs in einem Falkenkrankenhaus in Abu Dhabi: Dieser Ort existiert zu einem Teil für den Tourismus, er wird geformt und verändert durch die Besucher, die keinerlei Interesse an Falknerei mitbringen, sondern nur eine Aktivität „abhaken“ wollen. Was macht gutes Reisen also aus, wenn das bloße Umherziehen und Sammeln von Eindrücken kaum echten Mehrwert bringt? Historische Philosophen wie Emerson und Kant unternahmen Reisen selten oder nur aus Pflicht. Emerson differenzierte zwischen Reisen aus Notwendigkeit und jenen, die aus ästhetischem oder kulturellem Interesse durchgeführt werden.
Reisen, die tatsächlich Sinn ergeben, sind solche, bei denen kein Beweis für das eigene Dasein erbracht werden muss, weil man sich keine Anerkennung verschaffen will und ohne den Drang reist, eine Liste von Orten abzuarbeiten. Das Gefühl, besonders und einzigartig zu sein, das vielen Personen beim Reisen vermittelt wird, bezeichnet Agnes Callard als „delusion“, eine Illusion, durch die der Reisende glaubt, seine beste Version zu sein, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Dieses Phänomen verursacht eine Art Selbsttäuschung und verhindert echtes Erleben. Walker Percys Essay „The Loss of the Creature“ liefert dafür prägnante Illustrationen: Ein Touristenpaar, das zufällig ein spirituelles Fest in einem abgelegenen mexikanischen Dorf entdeckt und erst durch die Anwesenheit eines Experten überzeugt werden möchte, dass ihr Erlebnis authentisch sei. Diese Abhängigkeit von Dritten zur Bestätigung der eigenen Erfahrung zeigt, wie oberflächlich und indirekt touristische Wahrnehmungen oft sind.
Das Gesicht des „modernen Touristen“ ist der vorübergehend frei Zeit Habende, der eine Ortsveränderung sucht, um dem Alltag zu entkommen. Diese Bewegung ist häufig rein äußerlich und körperlich, ohne dass sich innerlich etwas ändert. Reisen wird zur Lokomotion – zum bloßen Hin- und Herbewegen. Dabei werden viele durchaus wertvolle Standards, etwa eigene Vorlieben in Kunst, Essen oder Freizeit, suspendiert, scheinbar um offen für Neues zu sein – doch diese Offenheit erweist sich oft als Floskel, da sie nicht auf eigenem Interesse basiert, sondern auf Erwartungen, was man als Tourist tun soll. Auch die Behauptung, dass Reisen zu einer größeren globalen Verbundenheit und einem besseren Verständnis der Menschheit führe, wird bestritten.
Fernando Pessoa und G.K. Chesterton argumentieren, dass die Distanzierung durch das Reisen die ethische und menschliche Verbindung untergräbt. Chesterton sieht darin sogar eine paradoxe Situation: Der Mensch in der Heimat fühlt eine tiefere Verbindung zu andersartigen Menschen, als derjenige, der ihnen tatsächlich begegnet und sie aus der Perspektive eines Zuschauers betrachtet. Zentral für die Kritik ist auch die Vorhersagbarkeit des Rückkehrers.
Nach einer Reise kehren die meisten Menschen mit ihren ursprünglichen Weltanschauungen, Interessen und Lebensweisen zurück. Das Erlebnis mag spannend und unterhaltsam gewesen sein, doch von echter Veränderung oder Transformation kann meist nicht die Rede sein. Der Tiefgang, der etwa bei bedeutenden Lebensveränderungen wie einem Studium, einem neuen Job oder einer Liebesbeziehung erfahren wird, bleibt beim Reisen oft aus. Wer glaubt, dass persönliche Reisen eine Ausnahme bilden und tatsächlich transformative Effekte zeigen, sollte vor allem auf fremde Beobachtungen und das Verhalten nach Rückkehr achten, denn Selbsteinschätzungen sind oft von Wunschdenken geprägt. Gerade Freunde und Bekannte, die nach einer Reise begeistert berichten, zeigen bei genauer Betrachtung selten tiefgreifende Veränderungen im Alltag.
Die Faszination des Reisens liegt vor allem in seinem Unterhaltungswert und der Abwechslung vom Alltag. Was jedoch rätselhaft bleibt, ist die Überhöhung des Reisens zu einer moralisch oder intellektuell erhabenen Tätigkeit. Dabei handelt es sich häufig um eine Flucht vor der eigenen Vergänglichkeit und dem stetigen Strom der Zeit. Reisen erzeugt eine Illusion von Sinn und entwickelt sich zur Ablenkung von der grundlegenden Erkenntnis, dass das Leben irgendwann endet und wir alle mit nichts zurückbleiben. Sokrates sagte einst, die Philosophie sei eine Vorbereitung auf den Tod.
Für viele Menschen ist hingegen das Reisen eine vergleichbare Vorbereitung – eine Möglichkeit, sich auf Abschied und Endlichkeit einzustimmen, in dem sie sich in Geschichten von Erlebnis, Wachstum und Veränderung einhüllen. Dabei bleibt aber häufig übersehen, dass echte persönliche Entwicklung nicht durch Ortswechsel entsteht, sondern durch Reflexion und Auseinandersetzung mit sich selbst. In einer Zeit, in der Mobilität und globale Vernetzung scheinbar grenzenlos scheinen, lohnt eine kritische Reflexion über den Sinn und Nutzen des Reisens. Nicht jeder Trip zu einer neuen Destination führt zu Wachstum oder echter Begegnung. Wer sich kontinuierlich nur von Reisen berauschen lässt, entgeht möglicherweise der Chance, tiefergehende Erfahrungen an einem Ort zu machen und das eigene Leben wirklich zu verändern.
Die Herausforderung besteht darin, Reisen mit einem bewussten, wertschätzenden und reflektierten Blick zu begegnen. Es geht weniger darum, möglichst viele Orte aufzusuchen als vielmehr um die Qualität der Erfahrung und die Bereitschaft, sich wirklichen Veränderungen zu öffnen – auch jenseits äußerer Umgebungen. So betrachtet, kann eine Reise nicht nur eine Flucht vor dem Alltäglichen, sondern eine Einladung zu einem echten Abenteuer der Seele sein.