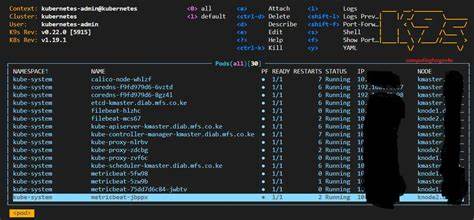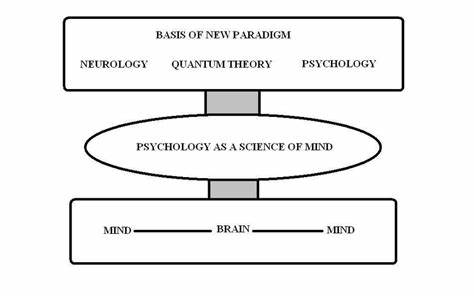In den letzten anderthalb Jahren haben sich die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) rasant weiterentwickelt. Für viele Entwickler und Unternehmen bedeutet dies nicht nur eine spannende Gelegenheit, sondern auch eine Reihe neuer Herausforderungen und Lernprozesse. Nach intensiver Praxis bei der Konstruktion und Integration von KI-Systemen bieten sich Erkenntnisse an, die wertvolle Orientierung bieten können – vor allem wenn es darum geht, unnötige Komplexität zu vermeiden und auf bewährte Methoden zu setzen. Ein zentraler Aspekt beim Umgang mit KI-gestützten Anwendungen ist die Gestaltung von Arbeitsabläufen. Häufig beobachten Entwickler, dass sie bei der Implementierung auf vermeintlich komplexere Agentensysteme setzen, obwohl einfache, gut strukturierte Workflows mit klar definierten Ablaufsteuerungen oft ausreichend sind.
Ein Workflow in diesem Kontext bedeutet nichts anderes als imperativer Code, der geschickt durch strategische Aufrufe von Sprachmodellen ergänzt wird. Diese Herangehensweise reduziert die Fehlerrate und macht die Systeme insgesamt zuverlässiger. Das Phänomen, dass man in KI-Projekten auf überdimensionierte Agenten-Frameworks oder komplexe Graphstrukturen zurückgreift, lässt sich auf einen weit verbreiteten Trend zurückführen: Den Drang, neue Werkzeuge und Abstraktionen zu entwickeln, noch bevor die gesamte Technologie und deren Anwendungsmuster klar erkennbar sind. Diese sogenannte „voreilige Kapselung“ führt häufig dazu, dass man versucht, allgemeingültige Lösungskonzepte zu bauen, die dann nicht den Erwartungen entsprechen, wenn sich das Technologieumfeld weiterentwickelt. In der KI-Branche ist ein besonderer Hype um Agentenframeworks, Vektordatenbanken und spezialisierte „Tool Provider“ entstanden.
Diese Technologien entwickeln sich oft zu regelrechten Modeerscheinungen, die viele Startups zum Anlass nehmen, eigene Produkte zu schaffen und zu bewerben. Doch hinter der beeindruckenden Oberfläche dieser Tools steckt oft eine Limitierung: Die auf den ersten Blick faszinierenden Demonstrationen, die man in kurzen Demos sieht, sind selten repräsentativ für die langfristigen Anforderungen im produktiven Betrieb. Dort zeigen sich bei großen Datenmengen und komplexen Interaktionen schnell Schwachstellen. Die größten Probleme bei der Produktivsetzung von LLM-basierten Systemen sind häufig weniger speziell auf KI zurückzuführen, sondern vielmehr klassische Softwareentwicklungsherausforderungen. Anforderungen wie die dauerhafte Speicherung von Daten, das Unterbrechen und Fortsetzen von Verarbeitungsvorgängen oder das Managen komplexer Zustandsautomaten werden am besten mit etablierten Lösungen adressiert.
So eignen sich bewährte Systeme wie Temporal zum Handling langlaufender Operationen oder xState zum Modellieren komplexer Verhalten als Graphen. Für die Speicherung von Vektoren bietet sich die Nutzung von Standarderweiterungen wie pgvector an, bevor zusätzliche spezialisierte Datenbanken in Betracht gezogen werden. Ein oft unterschätzter Vorteil beim Umgang mit Sprachmodellen ist die Verwendung von strukturierten Ausgaben. Diese Technik ermöglicht es, den Output des Modells so zu gestalten, dass er klar definierte und maschinenlesbare Informationen enthält. Dies erleichtert insbesondere das kontrollierte Aufrufen externer Werkzeuge und Funktionen.
Wenn ein LLM eigenständig Werkzeuge aufruft, besteht immer eine Restwahrscheinlichkeit, dass es die falschen Entscheidungen trifft oder gar keine Aktion auslöst. Die sicherere Strategie ist, die Ausgabe manuell zu interpretieren und die tatsächlich vorgesehenen Funktionen im Anwendungscode zu programmieren. Dadurch steigt die Zuverlässigkeit spürbar. Ein konkretes Beispiel verdeutlicht diesen Punkt: Wenn eine Anwendung wissen möchte, wie das Wetter in Melbourne ist, und ein „tool_getWeather“ zur Verfügung steht, kann das Modell zwar die richtige Antwort generieren oder aber auch eine veraltete oder ungenaue Antwort aus seinem Training reproduzieren. Nur durch das explizite Auslesen, welches Werkzeug aufgerufen werden soll, und den anschließenden Programmaufruf garantieren Entwickler eine konsistente und korrekte Ausführung.
Die AI-Entwicklergemeinschaft steht am Anfang eines Innovationszyklus, der vergleichbar ist mit anderen technologischen Revolutionen. Die großen Herausforderungen und Fehlentwicklungen, die man bei frühen Tools beobachtet, erinnern an Phasen, in denen zum Beispiel GraphQL als eigenständige Technologie anfänglich übertrieben beworben wurde, um später realistischere Anwendungsszenarien zu finden. Es ist klar, dass sich in Zukunft ein stabileres Ökosystem etablieren wird, in dem die Abstraktionen besser auf die tatsächlichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Neben technologischen Herausforderungen spielt auch der Marketing- und Investorendruck eine bedeutende Rolle. Der „Hype-Mechanismus“ der Startup-Szene führt dazu, dass viele Unternehmen abstrahierte Lösungen gewissen Trends folgend propagieren, um schnell Nutzerzahlen und Finanzierung zu generieren.
Dies begünstigt jedoch oft Suboptimalität, da die Realität komplexer und unsicherer ist als kurze Produktdemos suggerieren. Nachhaltiger Erfolg entsteht daher durch solides Engineering, pragmatischen Tool-Einsatz und das stete Hinterfragen der tatsächlichen Anforderungen. Das Fazit nach einem Jahr intensiver KI-Entwicklung ist ein klarer Appell zu pragmatischem Vorgehen. Statt auf undurchsichtige Agentenstrukturen und überkomplizierte Frameworks zu setzen, profitieren Entwickler von klaren Kontrollflüssen, strukturierten Modellausgaben und dem Einsatz bewährter Softwarepatterns und Tools. Der Schlüssel liegt sowohl im Verständnis der technischen Grenzen aktueller LLMs als auch im souveränen Umgang mit bestehenden Softwarearchitekturen.
Wer diese Grundprinzipien beherzigt, schafft stabile, wartbare und verlässliche KI-Anwendungen, die sich langfristig in vielfältigen Szenarien bewähren. So zeigt sich, dass der Entwicklungsprozess in der KI-Welt – trotz vieler Unwägbarkeiten und rapide wechselnder Trends – vor allem eine Rückbesinnung auf fundamentale Softwaretechnik ist. Konstruktives Experimentieren, kritisches Evaluieren und die Fähigkeit, über den Hype hinauszuschauen, sind unverzichtbare Eigenschaften für diejenigen, die sich in diesem zukunftsträchtigen Feld behaupten wollen.



![Simple Classification Rules Perform Well on Commonly Used Datasets (1993) [pdf]](/images/67EC114A-CC2E-4E83-9855-A5ADC0CD7275)