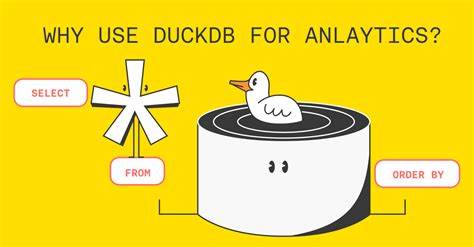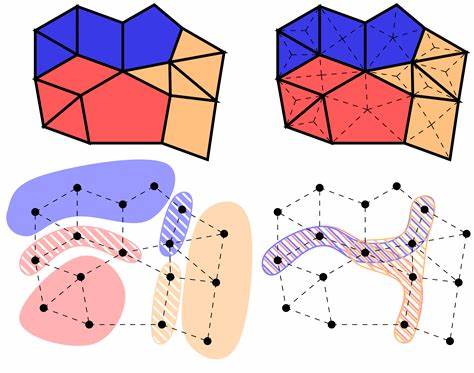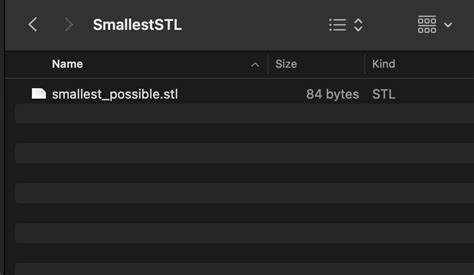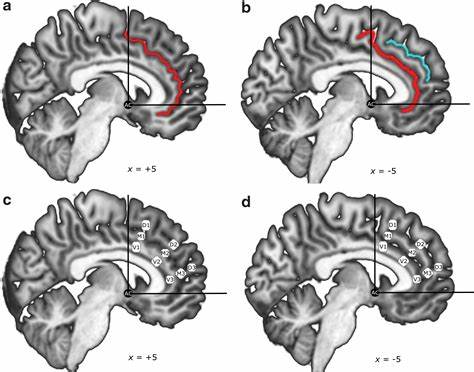Die Besteigung des Mount Everest gilt seit Jahrzehnten als ultimative Herausforderung des Alpinismus. Normalerweise erfordert der Aufstieg Wochen intensiver Vorbereitung, inklusive Akklimatisierung an die extrem dünne Luft in großer Höhe. Doch im Mai 2025 haben vier britische Bergsteiger dieses Zeitfenster dramatisch verkürzt. Sie erreichten den Gipfel des höchsten Berges der Erde und kehrten in weniger als einer Woche zurück – und das dank eines innovativen Hilfsmittels: dem Einatmen von Xenon-Gas. Diese Methode löst Begeisterung und Skepsis gleichermaßen aus und wirft grundlegende Fragen zur Zukunft des Bergsteigens auf.
Xenon ist ein Edelgas, das in der Medizin und Forschung bereits einige Anwendungen findet, etwa als Anästhetikum. Neu ist die Idee, dass es Bergsteigern dabei helfen kann, sich schneller an große Höhen anzupassen. Die dünne Luft auf dem Everest ist einer der größten Feinde für Kletterer. Höhenkrankheit mit Symptomen von Übelkeit, Kopfschmerzen bis hin zu lebensbedrohlichen Hirnschwellungen begleitet viele Expeditionen und zwingt die Kletterer, Pausen in Basiscamps einzulegen, um sich zu akklimatisieren. Laut dem Organisator der britischen Expedition wirkt das Inhalieren von Xenon offenbar als eine Art Beschleuniger dieses Prozesses.
Die vier Briten, die von London aus in Richtung Everest gestartet waren, erlebten dank des Gases eine schnelle und deutlich unkompliziertere Akklimatisierung. Ohne den mehrwöchigen Aufenthalt in großer Höhe nahmen sie den Aufstieg in Angriff und erreichten den Gipfel innerhalb weniger Tage. Für die Bergsteigergemeinschaft ist das eine Sensation, die so zuvor als unmöglich galt. Doch diese Rekordzeit hat nicht nur Bewunderung ausgelöst, sondern auch heftige Kontroversen.Traditionelle Bergsteiger sehen in dem Einsatz von Xenon-Gas eine Form der Leistungssteigerung, die das „wahre“ Erlebnis des Bergsteigens untergräbt.
Das Empfinden, seine eigenen Grenzen in der extremen Natur zu überwinden, sei durch chemische Hilfsmittel durchaus entwertet. Der Luxus, binnen weniger Tage auf den Everest zu steigen, könnte das Abenteuer für viele Menschen „konsumierbar“ machen, was puristischen Bergsteigern sauer aufstößt. Der Berg, der bislang als Inbegriff von physischer und mentaler Härte gilt, droht so seinen mythologischen Status zu verlieren. Die Zweifel sind dabei auch medizinischer Natur. Zwar gibt es Forschungsergebnisse, die eine positive Wirkung von Xenon auf die Sauerstoffversorgung und die Anpassung an den Höhenstress vermuten lassen, doch die Nebenwirkungen und langfristigen gesundheitlichen Risiken sind noch nicht ausreichend erforscht.
Ein Risiko, das viele Mediziner und Bergsteiger nicht ignorieren wollen.Die Reaktion der nepalesischen Regierung verdeutlicht die Tragweite des Vorfalls. Nepal, auf dessen Seite des Berges der Aufstieg beginnt, hat eine Untersuchung eingeleitet, um die rechtlichen und sicherheitstechnischen Aspekte dieser Praxis zu prüfen. Die Behörden machen deutlich, dass sie nicht bereit sind, eine solche Technik unreguliert zu zulassen, solange deren Folgen nicht vollständig verstanden sind. Der Everest zählt als Nationalheiligtum Nepals und als bedeutende Einnahmequelle durch den Bergtourismus, weshalb ein verantwortungsvoller Umgang mit Neuerungen essenziell ist.
Für den Organisator der Expedition, Lukas Furtenbach, stellt die Anwendung von Xenon-Gas jedoch eine echte Chance für die Zukunft des Bergsteigens dar. Er plant bereits ab 2026 kommerzielle Expeditionsprogramme, die den Auf- und Abstieg des Everest für zahlungskräftige Kunden innerhalb von zwei Wochen ermöglichen sollen. Diese Programme sollen auch eine Art Komfort und Sicherheit bieten, die den bisherigen komplexen und langwierigen Verfahren überlegen sind. Dies könnte den Markt revolutionieren, indem mehr Menschen den Traum vom Everest-Gipfel realisieren können, die bisher auf Grund der körperlichen Anforderungen oder Zeitinvestitionen davon Abstand genommen haben.Doch die ethische Debatte um das Thema bringt unweigerlich Fragen zur Authentizität des Bergsteigens auf.
Ist es noch Sport, wenn leistungssteigernde Substanzen eingesetzt werden? Wo liegen die Grenzen zwischen medizinischer Unterstützung und unfairer Hilfe? Die Diskussion um das Xenon-Gas könnte einen Wendepunkt markieren, der ähnlich radikale Veränderungen in den Regeln und der Wahrnehmung von extremem Bergsteigen mit sich bringt wie die Debatten im professionellen Radsport oder anderen Hochleistungssportarten. Auch stellt sich die Frage, welche Vorbildwirkung diese Methode auf Nachwuchsbbergsteiger weltweit haben wird. Das Risiko, unvorbereitet oder ohne medizinische Begleitung ähnliche Techniken anzuwenden, könnte die Zahl von Unfällen und Todesfällen erhöhen.Die Rolle der Technik auf großen Expeditionen hat sich historisch immer weiterentwickelt. Vielleicht ist das Xenon-Gas nur der nächste Schritt in einer Reihe von Innovationen, die den menschlichen Körper über seine natürlichen Grenzen hinaus unterstützen.
Gleichzeitig könnte diese Entwicklung den Berg immer schneller „entmystifizieren“ und den kulturellen und spirituellen Wert der Besteigung neu definieren oder gar schmälern.In jedem Fall wirft die britische Expedition eindrücklich die Frage auf, wie das extreme Bergsteigen sich in den kommenden Jahren verändern wird. Die Balance zwischen Innovation und Tradition, zwischen Risiko und Sicherheit, zwischen Kommerzialisierung und sportlicher Herausforderung scheint erneut in Bewegung geraten zu sein. Was bleibt, ist die Faszination für den höchsten Punkt der Erde – und die Spannung darüber, welche Rolle moderne Wissenschaft und Technik in der Zukunft von Everest und vielleicht auch anderen extremen Bergsteigerdestinationen spielen werden.