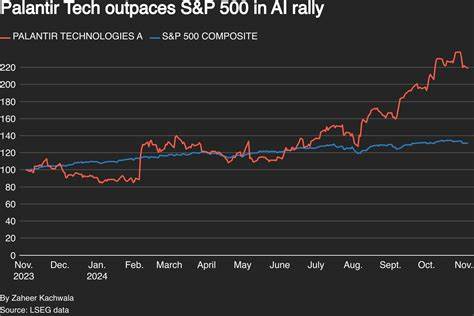Die Digitalisierung und der rasante Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz haben auch die Welt der Personalgewinnung grundlegend verändert. Insbesondere ChatGPT und ähnliche Sprachmodelle finden vermehrt ihren Weg in den beruflichen Alltag – sei es zur Unterstützung bei der Problemlösung, bei der Code-Generierung oder beim Verfassen von Texten. Dieser technologische Wandel wirft eine entscheidende Frage auf: Wie können Personalverantwortliche erkennen, ob Bewerber während des Interviews tatsächlich eigenes Wissen zeigen oder sich von solchen KI-Tools unterstützen lassen? Und wie lässt sich mit dieser neuen Realität konstruktiv umgehen? Diese Themen haben vor allem bei Remote-Interviews, in denen weder physische Präsenz noch direkte Beobachtung möglich sind, an Bedeutung gewonnen. Die Antwort darauf verlangt ein Umdenken sowohl in der Art der Befragung als auch in der Bewertung von Kompetenzen und Soft Skills. Das Kernproblem entsteht aus der Einfachheit, mit der durch ChatGPT schnell technische Antworten, Programmierlösungen oder theoretische Erklärungen generiert werden können.
Ein Kandidat kann per Kopieren und Einfügen korrekte Antworten liefern, ohne sie wirklich zu verstehen. Der klassische Fragenset durch standardisierte technische Aufgaben verliert dadurch erheblich an Aussagekraft. Dies macht den Einsatz traditioneller Interviewmethoden durchaus problematisch und weniger aussagekräftig. Eine erste Herangehensweise zur Verbesserung dieser Situation liegt im Konzept der Tiefe und Authentizität bei den Antworten. LLMs erzeugen typischerweise strukturierte, umfassend formulierte, aber oberflächliche Inhalte, die oft ohne konkrete persönliche Erfahrungen oder detaillierte Problemreflexionen bleiben.
Personaler können darauf achten, ob Antworten sehr generisch bleiben oder spezifische, individuelle Einblicke und nachweisbare eigene Lösungsansätze beinhalten. Hier ist es hilfreich, Nachfragen zu stellen, die auf den vorgelegten Antworten aufbauen, etwa durch Bitte um Erläuterungen zu einzelnen Schritten, Szenarien aus der Vergangenheit oder Detailfragen zur Umsetzung. Die Fähigkeit, spontan auf vertiefende Fragen einzugehen und eigenständig zu argumentieren, ist ein wertvolles Kriterium. Die Einführung von sogenannten „Take-Home Tasks“ kombiniert mit einer anschließenden, offenen Gesprächsrunde kann ebenfalls wirksam sein. Kandidaten erhalten eine komplexe Aufgabe, die sie in einem festgelegten Zeitraum bearbeiten können – mit oder ohne Verwendung von Hilfsmitteln.
Entscheidend ist jedoch das darauf folgende Interviewgespräch, bei dem Bewerber gebeten werden, ihre Vorgehensweise, getroffene Entscheidungen und aufgetretene Herausforderungen eingehend zu erläutern. So wird überprüft, inwieweit das erarbeitete Ergebnis verstanden wurde. Diese Methode fordert aktives Denken und schafft Transparenz hinsichtlich eigener Fähigkeiten. Darüber hinaus ist es wichtig, den Einsatz von ChatGPT nicht per se zu verteufeln, sondern konstruktiv in den Bewerbungsprozess einzubinden. In der heutigen Arbeitswelt werden KI-Tools zunehmend als hilfreiche Unterstützung gesehen, die kreativ eingesetzt den Arbeitsalltag erleichtern können.
Personalverantwortliche könnten offen kommunizieren, dass die Nutzung solcher Technologien unter Berücksichtigung von Ethik und Eigenleistung erlaubt ist. Die Herausforderung liegt dann darin, herauszufinden, wie die Erkenntnisse aus der KI-Nutzung tatsächlich im eigenen Denken verankert wurden und wie eigenständig die Lösungen entwickelt sind. In diesem Kontext kann auch die Gestaltung des Interviews zugunsten einer kooperativen Gesprächsatmosphäre verändert werden. Statt strikter Prüfung entsteht so ein Dialog, der Raum für Diskussion und gemeinsames Nachdenken lässt. Kandidaten können etwa ein paar Minuten zur Vorbereitung auf eine komplexe Fragestellung bekommen, die sie anschließend erläutern und mit dem Interviewer besprechen.
Dies senkt den Stress und ermöglicht es auch Personen mit Prüfungssituationsangst, ihre Fähigkeiten realitätsnah einzubringen. Wenn es unbedingt gilt, eine möglichst authentische Leistung des Kandidaten sicherzustellen, bleibt allerdings die persönliche Anwesenheit eine verlässliche Methode. Präsenzinterviews bieten die Chance, nonverbale Signale, spontane Reaktionen und den direkten Wissensaustausch zu beobachten – Aspekte, die selbst ausgeklügelte Monitoring-Systeme bei virtuellen Interviews nur eingeschränkt abdecken können. Dennoch ist dies in Zeiten von globalen Talenten und Remote Work nicht immer praktikabel. Technologische Lösungen allein sind daher nur begrenzt effektiv.
Kontrollmechanismen wie Bildschirmüberwachung, Kameraaufzeichnung oder das Sperren externer Geräte können leicht umgangen werden und fühlen sich oft invasiv an. Stattdessen gewinnt die Entwicklung neuer Interviewformate an Bedeutung, die den realen Arbeitsalltag besser nachbilden und auf gegenseitiges Vertrauen und offene Kommunikation setzen. Nicht zuletzt bietet die Sensibilisierung aller Beteiligten für die aktuellen Herausforderungen einen wertvollen Beitrag. Sowohl Kandidaten als auch Interviewer sollten frühzeitig darüber informiert werden, welche Erwartungen an Eigenständigkeit und Ehrlichkeit bestehen und warum bestimmte Vorgehensweisen gewählt werden. Transparenz hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die Basis für eine faire Bewertung zu schaffen.
Zusammenfassend zeigt sich, dass das Erkennen und der Umgang mit Kandidaten, die ChatGPT in Interviews nutzen, einen umfassenden Ansatz erfordert. Statische Fragemuster müssen dynamischer, dialogorientierter werden. Die Integration von Aufgaben mit anschließendem tiefgehenden Gespräch, die Offenheit gegenüber KI-Unterstützung, das Fördern von Authentizität sowie flexible Interviewformate stellen wirksame Strategien dar. Auf diese Weise können Recruiter nicht nur die tatsächlichen Kompetenzen besser herausarbeiten, sondern auch eine inklusive und zukunftsfähige Interviewkultur etablieren, die den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht wird.