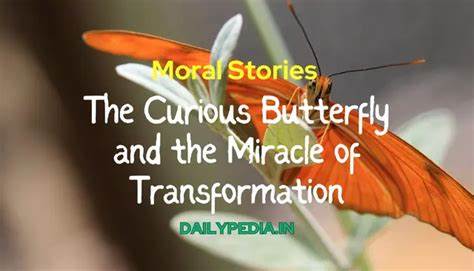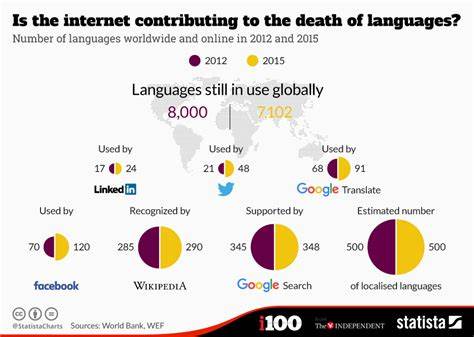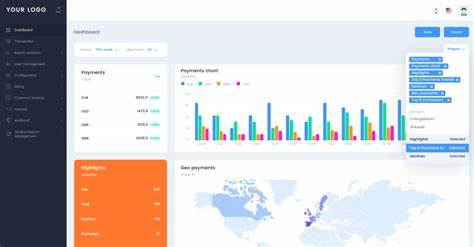Die faszinierende Geschichte der menschlichen Besiedlung im Mittelmeerraum erhält eine neue Wendung: Eine aktuelle internationale Studie offenbart, dass Jäger und Sammler bereits vor rund 8500 Jahren Malta erreichten – und das weit vor der Ankunft der ersten landwirtschaftlichen Gemeinschaften. Diese Entdeckung, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, hebt die maritime Kompetenz und Anpassungsfähigkeit unserer frühesten Vorfahren hervor und liefert wichtige Einblicke in die frühe menschliche Mobilität und das Überleben auf abgelegenen Inseln. Im Gegensatz zur bisherigen Annahme, dass kleine und weitläufig isolierte Inseln wie Malta erst mit dem Aufkommen der Landwirtschaft besiedelt wurden, zeigen die jüngsten archäologischen Funde, dass die erste menschliche Präsenz auf Malta durch Jäger und Sammler erfolgte, die eine bemerkenswerte lange Seereise von mindestens 100 Kilometern über offenem Meer zurücklegten. Diese Reise fand wohl in einfachen, rudimentären Booten – vermutlich gezimmerten Einbäumen – statt, was angesichts der Abwesenheit von Segeln und moderner Navigationstechniken eine erstaunliche Leistung ist. Die Ausgrabungen in der Höhle von Latnija im Norden der Insel, geleitet vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Deutschland sowie der Universität Malta, offenbaren eine beeindruckende Bandbreite an artefaktischen und biologischen Spuren.
Die Forscher fanden Steinwerkzeuge, verbrannte Feuerstellen und Reste von Nahrungsmitteln, die eine nachhaltige Nutzung der vorhandenen Ressourcen belegen. Besonders bemerkenswert ist die Vielfalt der entdeckten Tierknochen, die auf eine breit gefächerte Ernährung hinweisen – von Rotwild über Vögel bis hin zu Schildkröten und sogar Füchsen. Diese Entdeckung wirft ein neues Licht auf die ökologische Geschichte Maltas und anderer kleiner mediterraner Inseln. Einige der Tierarten, deren Überreste gefunden wurden, galten bislang als bereits ausgestorben zu dieser Zeit. Die Archäofaunistik zeigt zudem, dass die damaligen Jäger und Sammler neben einer Vielzahl von Landtieren auch marine Ressourcen intensiv nutzten.
Neben Seehunden, diversen Fischarten wie Zackenbarschen, fanden sich Überreste von essbaren Meeresschnecken, Krabben und Seeigeln, die alle eindeutig gekocht waren. Diese Ernährungsweise führte wahrscheinlich dazu, dass die bevorstehende Herausforderung, auf einer kleinen Insel mit begrenzten Ressourcen zu überleben, erfolgreich gemeistert wurde. Die Bergung und Analyse der Tierknochen erfolgte unter anderem durch Dr. Mathew Stewart vom Australian Research Centre for Human Evolution. Seine Untersuchungen ermöglichen es, präzise Rückschlüsse auf die Jagdpraktiken und Ernährungsmuster der mesolithischen Inselbewohner zu ziehen.
Er betont, dass durch die vielseitige Nutzung von Land- und Meerestieren eine ökologische Nische geschaffen wurde, die das Überleben der Menschen in einem isolierten Umfeld ermöglichte. Das aufregende an diesen Funden ist nicht nur die Geschichte der ersten Besiedlung, sondern auch das damit verbundene Umdenken bezüglich der technologischen und sozialen Fähigkeiten der damaligen Jäger und Sammler. Bislang galt angenommen, dass komplexe Seefahrt und die Besiedlung entlegener Inseln eine Errungenschaft der neolithischen Bauernkulturen und damit späterer Epochen sind. Die jetzigen Erkenntnisse verlagern diesen Wendepunkt um etwa 1000 Jahre zurück und zeigen, dass auch zuvor schon komplexe maritime Unternehmungen unternommen wurden. Ein weiterer Aspekt der Überlegungen ist die mögliche Verbindung zwischen mesolithischen Gruppen über das Mittelmeer hinweg.
Die Existenz von langen Seereisen legt nahe, dass frühe Gesellschaften nicht völlig isoliert lebten, sondern durch maritime Netzwerke miteinander verbunden waren. Diese Vernetzung hätte vermutlich Einfluss auf den Austausch von Ressourcen, Technologien und kulturellen Praktiken gehabt. Die Forschung belastet zudem die Annahme, dass kleine Inselökosysteme vor menschlichem Einfluss weitgehend unberührt waren. Die Jagd durch die frühen Menschen könnte zur Ausrottung bestimmter endemischer Tierarten geführt haben beziehungsweise deren Populationen entscheidend vermindert haben. Daraus ergeben sich auch neue wissenschaftliche Fragestellungen, wie die Mensch-Tier-Beziehung in prähistorischen Zeiten und der Einfluss menschlicher Aktivitäten auf fragile Ökosysteme bewertet werden müssen.
Professor Eleanor Scerri vom Max-Planck-Institut und Hauptautorin der Studie unterstreicht die große Bedeutung dieser Entdeckung. Sie beschreibt, wie die Ergebnisse einen Paradigmenwechsel in der Forschung zur europäischen Vorgeschichte einleiten und zur Neubewertung der maritimen Fähigkeiten von Europas letzten Jägern und Sammlern beitragen. Die Daten erweitern nicht nur die zeitliche Dimension der menschlichen Präsenz auf Malta erheblich, sondern verweisen auch auf eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit unter schwierigen Umweltbedingungen. Die Erkenntnisse aus Malta werden durch Studien in vergleichbaren Regionen gestützt, die ebenfalls frühe Seefahrten und menschliche Migrationen auf entlegene Inseln dokumentieren. Gemeinsam ergeben diese Forschungen ein komplexeres Bild der menschlichen Evolution, in der mobilitäts- und innovationsfreudige Jäger und Sammler eine viel entscheidendere Rolle einnahmen als bisher vermutet.
Ebenfalls bemerkenswert ist, wie die multidisziplinäre Herangehensweise – von wissenschaftlichen Methoden wie der Isotopenanalyse von Tierknochen bis hin zu archäologischen Ausgrabungen – das Puzzle der frühen Besiedlung Maltas zusammenfügt. Diese Kombination von Fachgebieten demonstriert, wie moderne Technologien und interdisziplinäre Zusammenarbeit unser Verständnis der Vergangenheit revolutionieren können. Diese Entdeckung passt auch in den größeren Kontext der Nachhaltigkeitsforschung. Indem wir begreifen, wie prähistorische Menschen mit begrenzten natürlichen Ressourcen auf Inseln erfolgreich auskamen, gewinnen wir wertvolle Einsichten in nachhaltiges Verhalten und die Balance zwischen menschlichem Handeln und Ökosystemen. So tragen archäologische Forschungen indirekt zum heutigen Verständnis der Nachhaltigkeitsziele bei – insbesondere Ziel 15 der UN, das sich mit dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung von Landökosystemen befasst.
Abschließend stellt die Reise der mesolithischen Jäger und Sammler nach Malta vor 8500 Jahren nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte der Seefahrt dar, sondern fordert auch unser Verständnis menschlicher Kulturentwicklung heraus. Sie zeigt, dass schon sehr früh komplexe maritime Fähigkeiten vorhanden waren und dass menschliche Gruppen bereits in prähistorischer Zeit die Fähigkeit besaßen, isolierte Inseln zu erreichen und zu besiedeln. Dieses Wissen bereichert die Archäologie und Anthropologie mit einer neuen Perspektive auf die Dynamik früher menschlicher Gesellschaften und legt den Grundstein für zukünftige Forschungen in der Mittelmeerregion und darüber hinaus.