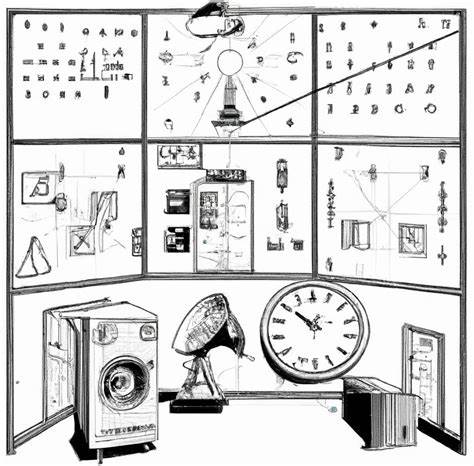Die Elektrifizierung des Verkehrssektors gehört zu den größten Herausforderungen der modernen Technologie. Während Elektroautos mittlerweile immer häufiger auf unseren Straßen zu sehen sind, bleibt der Antrieb größerer Verkehrsmittel wie Flugzeuge, Schiffe und Züge ein komplexes Problem. Die Grenzen herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien machen sogenannte „große elektrische Mobilitätsprojekte“ schwierig, insbesondere wegen des Gewichts und der begrenzten Energiedichte der aktuellen Akkutechnologien. Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben nun eine innovative Lösung vorgestellt, die die elektrische Luftfahrt fundamental verändern könnte: eine Hochleistungsbrennstoffzelle auf Natriumbasis, die herkömmliche Batterien in Sachen Energie-zu-Gewicht-Verhältnis deutlich übertrifft. Im Gegensatz zu den dominierenden Lithium-Ionen-Batterien setzt die neue Technologie auf flüssiges Natriummetall als Brennstoff.
Dieser Ansatz ermöglicht nicht das herkömmliche Aufladen der Energiespeicher, sondern den Austausch des verbrauchten Natriums. Die Brennstoffzelle besteht aus zwei getrennten Kammern: Eine Kammer enthält das flüssige Natriummetall, die andere ist mit Sauerstoff aus der Luft gefüllt. Zwischen den beiden liegt eine keramische Elektrolyt-Barriere, durch die Natriumatome wandern, um mit Sauerstoff an einer porösen Elektrode zu reagieren. Dieser chemische Prozess erzeugt elektrische Energie mit einem beeindruckenden Energie-zu-Gewicht-Verhältnis, das in Prototyp-Tests bereits das Dreifache herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien erreicht hat. Ein besonders wichtiger Aspekt dieser Entwicklung ist die Energiedichte.
Für die realistische Nutzung in der elektrischen Luftfahrt wird eine Energiedichte von rund 1.000 Wattstunden pro Kilogramm benötigt. Herkömmliche Batterien liefern heute etwa 300 Wattstunden pro Kilogramm und stoßen somit an ihre physikalischen Grenzen. Die Natrium-Brennstoffzelle des MIT-Teams erzielte in Tests sogar bis zu 1.700 Wattstunden pro Kilogramm, was einen enormen Fortschritt darstellt und die Tür zu praktischen Anwendungen gerade in der regionalen Luftfahrt öffnen könnte.
Gerade Kurzstreckenflüge, die rund 30 Prozent der Emissionen in der Luftfahrt ausmachen und 80 Prozent des innerstaatlichen Flugverkehrs abdecken, könnten von dieser Technologie massiv profitieren. Neben der Luftfahrt bringt das Konzept auch Vorteile für andere schwerpunktmäßige Verkehrsträger mit sich. Schiffe oder Züge, die große Energiedichten bei überschaubaren Betriebskosten benötigen, könnten mit der Natrium-Brennstoffzelle wirtschaftlicher und umweltschonender betrieben werden. Natrium als Rohstoff trägt zusätzlich dazu bei, da es günstig und reichlich verfügbar ist. Gewonnen wird Natrium aus Kochsalz, und sein vergleichsweise niedriger Schmelzpunkt von 98 Grad Celsius erleichtert die Handhabung und das Betanken der Brennstoffzelle.
Die Idee von Metall-Luft-Batterien, insbesondere auf Basis von Natrium oder Lithium, ist nicht neu. Ihre theoretische Energieausbeute ist seit vielen Jahren bekannt und hat Forscher weltweit fasziniert. In der Praxis waren jedoch technische Herausforderungen wie die begrenzte Wiederaufladbarkeit und mechanische Stabilität bisher unüberwindbar. Das MIT-Team hat nun einen innovativen Weg gefunden, die uralte Idee in Form eines Brennstoffzellen-Systems zu verwirklichen und dadurch nicht auf das Aufladen per Strom angewiesen zu sein, sondern auf den Brennstoffaustausch zu setzen. Dadurch umgeht das System die typischen Limitierungen herkömmlicher Batterien und könnte eine nachhaltige, praktikable Alternative darstellen.
Der Prototyp ist in zwei Variationen gebaut worden. Ein Design erinnert an ein vertikales Glasrohr mit einer zentralen keramischen Elektrolytschicht und poröser Sauerstoffelektrode, flankiert von Kammern für Natrium und Luft. Das Reaktionsgeschehen findet im mittleren Rohr statt, während das Natrium nach und nach verbraucht wird. Ein weiteres Design nutzt eine horizontale Anordnung mit einem Natriumtray über der keramischen Elektrolyt-Elektroden-Kombination. Beide Varianten haben in Kontrollversuchen die Erwartungen übertroffen und die Zielwerte für die Energiedichte klar überschritten.
Ein weiterer Vorteil dieser Brennstoffzelle ist die Umweltfreundlichkeit der Nebenprodukte. Im Gegensatz zu fossilen Verbrennungsmotoren, die Kohlendioxid und andere Schadstoffe ausstoßen, produziert das System Natriumoxid, das in der Atmosphäre zu Natriumbicarbonat (auch bekannt als Backpulver) umgewandelt wird. Dieses chemische Produkt könnte sogar dazu beitragen, die Versauerung von Gewässern zu reduzieren, indem es Säuren neutralisiert. So verbinden sich ökologische Vorteile mit ökonomischer und technologischer Innovation in einer äußerst attraktiven Weise. Sicherheit spielt bei der Entwicklung ebenfalls eine große Rolle.
Konventionelle Batterien bergen das Risiko von Bränden oder Explosionen, wenn die Barrieren innerhalb der Zelle versagen und reaktive Materialien unkontrolliert reagieren. Im Gegensatz dazu trennt das MIT-System die Luftkammer von der Natriumkammer, was das Risiko von gefährlichen Zwischenfällen minimiert. Diese Eigenschaft erhöht die Eignung der Brennstoffzelle gerade für den Einsatz in der Luftfahrt, wo Sicherheitsstandards extrem hoch sind. Der Übergang vom Labor in die Praxis scheint vielversprechend. Eine Ausgründung namens Propel Aero wurde bereits gegründet, um die Technologietransferphase zu beschleunigen und die Produktion zu skalieren.
Dabei hilft auch die Tatsache, dass Natrium heute industriell bereits in großen Mengen hergestellt wird, wenn auch aktuell weniger als in der Zeit, als es in bleihaltigem Benzin Verwendung fand. Die Verfügbarkeit des Rohstoffs ist somit kein Engpass, und die für den Betrieb notwendige Infrastruktur könnte relativ schnell aufgebaut werden. Das nächste ehrgeizige Ziel des MIT-Teams besteht darin, eine große Drohne mit einem einzigen Brennstoffzellenmodul mit einer Kapazität von circa 1.000 Wattstunden zu betreiben. Die Brennstoffzelle ist ungefähr so groß wie ein Ziegelstein, was das Potenzial für eine flexible und kompakte Integration in zukünftige Flugzeuge zeigt.