Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in Den Haag, Niederlande, steht seit Jahren im Fokus globaler Diskussionen über Völkerrecht, Kriegsverbrechen und internationale Gerechtigkeit. Doch seit Februar 2025 befindet sich die Institution in einer beispiellosen Krise. Präsident Donald Trump hat Sanktionen gegen den Chefankläger des IStGH, Karim Khan, verhängt, die gravierende Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Tribunals haben. Diese Maßnahmen haben nicht nur die Arbeitsfähigkeit des Gerichts beeinträchtigt, sondern auch die Zukunft der internationalen Strafjustiz infrage gestellt. Die Sanktionen demonstrieren die komplexe Verflechtung von Politik, Recht und Menschenrechten in der globalen Arena und beleuchten zugleich die Herausforderung, vor denen internationale Organisationen stehen, wenn mächtige Staaten ihren Einfluss geltend machen.
Die Gründe für die Sanktionen wurzeln in der Entscheidung des IStGH, im November 2024 Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu sowie den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant auszustellen. Die Gerichtsurteile basieren auf Ermittlungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen während Israels Militäroperationen gegen Hamas im Gazastreifen, darunter die absichtliche Zielrichtung auf Zivilisten und Einschränkungen humanitärer Hilfe. Israel bestreitet diese Vorwürfe vehement und bezeichnet die Ermittlungen als ungerechtfertigt und politisch motiviert. Die USA, unter der Führung Trumps, schlossen sich dieser Haltung an und erklärten, der ICC habe keine Gerichtsbarkeit über Israel. Die Sanktionen gegen Karim Khan gehen weit über eine bloße politische Verurteilung hinaus und umfassen den Entzug des Zugangs zu Bankkonten, E-Mail-Konten und Reisebeschränkungen.
Khan verlor beispielsweise den Zugang zu seiner Microsoft-E-Mail-Adresse und musste auf den schweizerischen Anbieter Proton Mail ausweichen. Seine Bankkonten in Großbritannien wurden eingefroren. Dies erschwert nicht nur die Kommunikation des Chefanklägers, sondern behindert auch wirtschaftliche Transaktionen und damit die Logistik der Ermittlungen und Prozesse. Die Konsequenzen für die internationale Strafjustiz sind tiefgreifend. Mitarbeiter des Gerichts mit amerikanischer Staatsbürgerschaft wurden gewarnt, bei Reisen in die USA mit Verhaftung bedroht zu sein.
Mehrere US-basierte Menschenrechtsorganisationen haben aus Angst vor Sanktionen ihre Zusammenarbeit mit dem IStGH eingestellt oder stark eingeschränkt. Das führt zu einem Mangel an Unterstützung bei der Beweisaufnahme, Zeugensicherung und anderen essenziellen Tätigkeiten im Rahmen von Ermittlungen. Das Tribunal ist auf die Kooperation von NGOs, Vertragsunternehmen und Staaten angewiesen, da es keine eigene Exekutiv- oder Durchsetzungsbefugnis besitzt. Die Sanktionen vergraulen diese Partner, da Banken und Technologieunternehmen auch Sanktionen befürchten. So berichteten Mitarbeiter des Gerichts, dass NGOs sensible Finanzmittel aus US-Konten abzogen, um Beschlagnahmungen zu vermeiden.
Auch wichtige EU-Länder verweigerten teilweise die Ausführung von Haftbefehlen, was darauf hindeutet, dass selbst sonstige Befürworter der internationalen Strafjustiz zunehmend rechtliche und politische Bedenken entwickeln. Die humanitäre Dimension dieser Entwicklung ist alarmierend. Experten warnen, dass Sanktionen gegen den Chefankläger nicht nur die Arbeit des Gerichtshofs lähmen, sondern auch den Opfern von Kriegsverbrechen und Völkermord den Zugang zu Gerechtigkeit verwehren. Human Rights Watch äußerte, dass genau diese Maßnahmen verhindern, dass Opfer Gehör finden und Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Ohne effektive Strafverfolgung steigt die Gefahr von Straflosigkeit, die wiederum neue Gewalt und Menschenrechtsverletzungen begünstigt.
Gerichte wie der IStGH sind zentral, um internationalen Frieden und Sicherheit langfristig zu fördern. Der Fall erinnert an ähnliche Spannungen, die schon während der Amtszeit des früheren Chefanklägers Fatou Bensouda entstanden. 2020 verhängte die Trump-Regierung bereits Sanktionen gegen Bensouda und ihre Vertreter aufgrund der Untersuchung von mutmaßlichen US-Militärverbrechen in Afghanistan. Diese „Härte“ gegenüber dem Gericht zeigt die wiederkehrenden politischen Konflikte zwischen nationaler Souveränität, Machtpolitik und internationalem Recht. Präsident Joe Biden hob die Sanktionen gegen Bensouda später auf, was als Versuch gewertet wurde, den multilateralen Dialog wiederherzustellen.
Die aktuellen Sanktionen gegen Karim Khan zeigen jedoch, dass die Probleme nicht gelöst sind und sich durch neue politische Spannungen verschärfen können. Neben operativen Hindernissen gerät der IStGH auch in eine interne Krise. Eine Reihe von Anschuldigungen gegen Khan wegen Fehlverhaltens und Machtmissbrauchs beeinträchtigt das Vertrauen in die Führung des Gerichts. Während Khan die Vorwürfe energisch zurückweist, läuft eine UN-Untersuchung, und es gibt Berichte über Repressalien gegen Kritiker innerhalb des Tribunals. Die Kombination aus externem Druck durch Sanktionen und internen Konflikten erschwert den Fortbestand der Institution und den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit.
Die amerikanische Regierung rechtfertigt die Sanktionen mit dem Schutz ihrer nationalen Souveränität und der Sicherheit ihrer Truppen weltweit. Die USA argumentieren, dass die Ermittlungen des IStGH in Bezug auf Israel sowie auf US-Personal rechtswidrig und politisch motiviert seien. Dabei steht die Tatsache im Raum, dass die USA den ICC bis heute nicht vollständig anerkennen und kein Mitglied sind. Die Sanktionen sollen offenbar eine abschreckende Wirkung erzielen und ein Exempel statuieren für institutionelle Herausforderungen an amerikanische Außenpolitik. Diese Konstellation verschärft die Gräben in internationalen Beziehungen.
Staaten wie Israel verstärken zudem nationale Gesetze zur Verhinderung von Beweiserteilung an den IStGH. Das führt zu einer Spirale des Misstrauens, die das Prinzip der universellen Strafverfolgung untergräbt. Die Vorstellung, dass niemand, auch keine Staats- oder Regierungschefs, über dem Gesetz steht, droht durch derartige Machtspiele erodiert zu werden. Das Tribunal steht jedoch vor der Herausforderung, seine Wirksamkeit zu bewahren unter zunehmend widrigen Bedingungen. Die Abschottung der Chefprozessorin gegen fundamentale Arbeitsschritte und die Einschränkungen für amerikanische Mitarbeiter erzeugen personelle Fluktuation und toxische Arbeitsbedingungen.
Ein Teil der Belegschaft hat das Tribunal bereits verlassen, und weitere Austritte sind nicht auszuschließen. Zugleich haben mehrere Klagen vor US-Gerichten begonnen, die diese Sanktionen als Eingriffe in die Meinungsfreiheit und die Rechtsstaatlichkeit brandmarken. Ein Anwalt des IStGH für den Sudan-Fall erreichte zwischenzeitlich eine einstweilige Verfügung gegen Strafmaßnahmen, aber umfassende Lösungen sind noch ausständig. Der Fall illustriert die enorme Bedeutung einer unabhängigen internationalen Justiz und zeigt gleichzeitig ihre verletzliche Stellung im weltpolitischen Kontext. Die Zukunft des Internationalen Strafgerichtshofs hängt stark von der Bereitschaft der Staatengemeinschaft ab, ihn zu unterstützen und politische Einflussnahme zugunsten von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zurückzudrängen.
Nur so lässt sich gewährleisten, dass Opfer von Kriegsverbrechen und Völkermord weltweit Zugang zu Gerechtigkeit erhalten. Insgesamt steht der Internationale Strafgerichtshof an einem Scheideweg. Die durch die Sanktionen ausgelöste Arbeitsblockade ist ein historisches Novum in der jüngeren internationalen Rechtsgeschichte. Die Debatte um die Rechtmäßigkeit der Sanktionen und die Rolle der USA als Weltmacht wird die Entwicklung des Tribunals zunehmend prägen. Die Konflikte verdeutlichen zudem, wie sehr internationale Institutionen auf die Kooperation mächtiger Staaten angewiesen sind und wie fragile das Geflecht aus Rechtsprinzipien, politischem Willen und diplomatischem Pragmatismus bleibt.
In einer Zeit, in der weltweit Kriegsverbrechen, Terrorismus und Menschenrechtsverletzungen nach wie vor akute Probleme darstellen, ist die Rolle des IStGH essenziell. Die Einschränkungen durch die Sanktionen werfen die Frage auf, ob die internationale Gemeinschaft gewillt ist, globalen Rechtsstaatlichkeit den nötigen Schutz und die Unterstützung zu gewähren, um die Verbrechen der Vergangenheit vor Gericht zu bringen und künftige abzuschrecken. Die Entwicklungen rund um den ICC und die US-Sanktionen markieren deshalb einen Wendepunkt, dessen Auswirkungen weit über die Jurisdiktion des Gerichts hinausreichen.
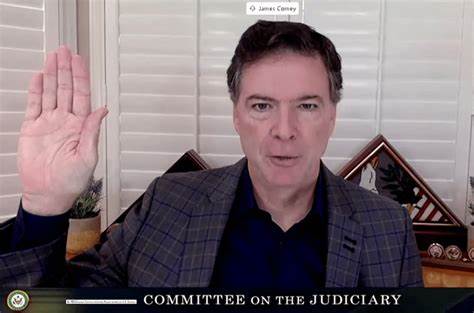


![Aurura time-lapses from space captured by NASA's Don Pettit [video]](/images/98B56D17-D463-4745-B04F-D48135D68B81)
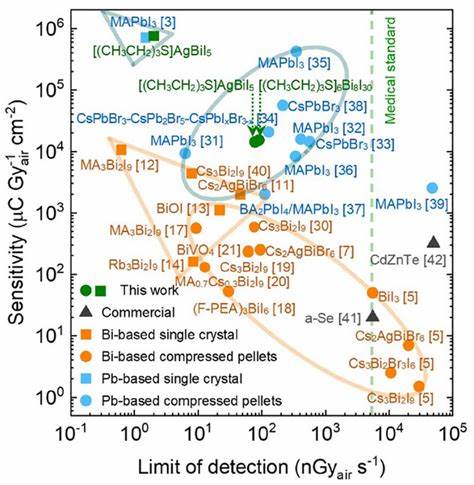
![A Resolution in Response to the Adoption of ChatGPT Edu at CSU Northridge [pdf]](/images/F3CE0BC7-E47D-47C7-9798-991196E6414F)



