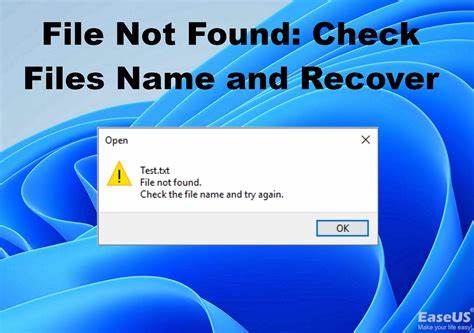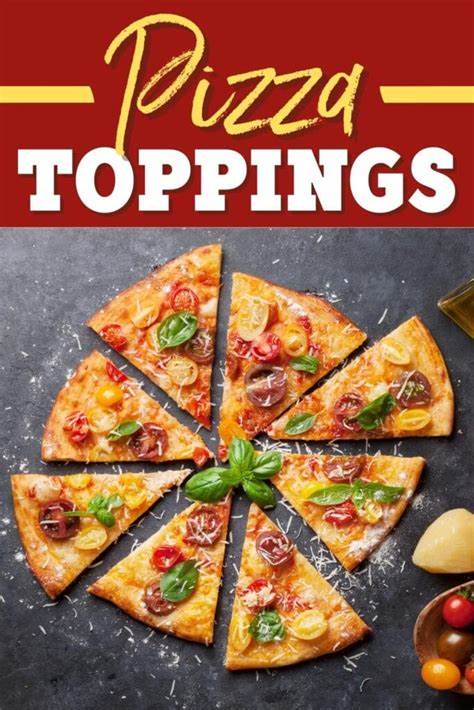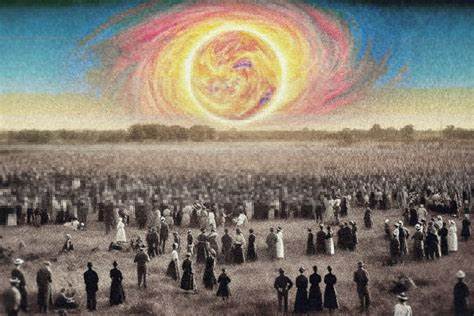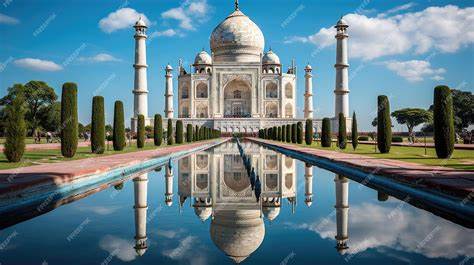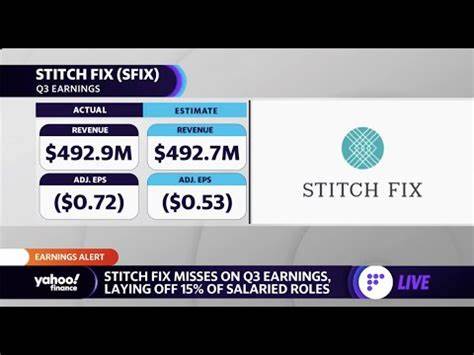In der heutigen digitalen Ära scheint es selbstverständlich, mit Computern zu arbeiten und Dokumente effizient zu verwalten. Doch eine tiefgreifende Veränderung im Verständnis der Datei- und Ordnerstrukturen bei der jungen Generation stellt Lehrende vor unerwartete Herausforderungen. Seit etwa 2017 beobachten zahlreiche Professoren und Dozenten, dass Studierende mit traditionellen Konzepten wie Dateien, Ordnern und Verzeichnissen zunehmend Schwierigkeiten haben. Dieses Phänomen ist eng verbunden mit der Entwicklung und dem Einfluss moderner Technologien, die das Nutzerverhalten prägen und verändern. Der Begriff „Datei“ und seine Platzierung in einer hierarchisch organisierten Ordnerstruktur, welcher für ältere Generationen selbstverständlich ist, wird für viele junge Menschen immer abstrakter.
Stattdessen überwiegt ein mentaler Ansatz, bei dem alle Dateien in einem einzigen „großen Eimer“ liegen – eine Ansammlung, die eher einem chaotischen Haufen gleicht als einer durchdachten Struktur. Professores wie Catherine Garland aus dem Bereich Ingenieurwesen haben dieses Problem früh erkannt, als sie bemerkte, dass Studierende nicht mehr wissen, wo ihre Dateien gespeichert sind oder wie sie diese finden können. Ihre Studierenden waren irritiert, wenn sie nach dem Speicherort gefragt wurden, weil ihnen das Konzept eines Speicherorts an sich fremd erschien. Diese Diskrepanz rührt unter anderem daher, dass viele der jungen Nutzer mit Cloud-Diensten, Smartphones und Anwendungen aufgewachsen sind, welche Suchfunktionen und dynamischen Content-Zugriff in den Mittelpunkt stellen. Plattformen wie Google Drive, Dropbox, Instagram oder TikTok fördern ein anderes Nutzungsverhalten, bei dem Dateien und Medieninhalte nicht mehr physisch in Ordnern abgelegt und gesucht werden, sondern einfach über Suchbefehle oder Empfehlungen gefunden werden können.
Die Vorstellung, eine Datei zunächst an einem bestimmten Ort abzulegen und später genau dort wieder aufzusuchen, entspricht nicht mehr der alltäglichen Nutzung digitaler Geräte. Dazu kommt die Entwicklung moderner Betriebssysteme, die Ordnerstrukturen immer mehr verbergen oder intuitiver gestalten wollen, sodass Nutzer im Alltag weniger mit der eigentlichen Struktur interagieren. Windows oder macOS bieten inzwischen mächtige Suchfunktionen wie Windows Search oder Spotlight, mit denen Dateien blitzschnell gefunden werden können. Für viele junge Menschen sind diese Features so selbstverständlich, dass sie gar nicht mehr lernen müssen, bewusst Ordner anzulegen oder Dateien systematisch zu organisieren. Ein weiterer Faktor, der zu diesem veränderten Verständnis beiträgt, ist der Wandel in den Vermittlungsinhalten der Schulen.
Die Schwerpunkte verschieben sich zunehmend hin zu sogenannten „21st-century skills“, wobei der Fokus auf Soft Skills, Programmen wie Scratch oder ähnlichem sowie auf kollaborativem Arbeiten liegt, anstelle digitaler Grundkenntnisse wie Dateiverwaltung. Das führt dazu, dass viele Studierende ohne fundierte Vorkenntnisse in der Navigation klassischer Ordnerstrukturen in kollaborative und forschungsbasierte Studiengänge einzahlen. Gerade in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) führt das jedoch zu bedeutenden Herausforderungen. Diese Disziplinen arbeiten häufig mit großen Datenmengen, wissenschaftlichen Programmen und Skripten, die exakte Pfadangaben verlangen. Hier ist das systematische Ablegen und Wiederfinden von Dateien essenziell – Prozesse, die per Suchfunktion nicht einfach ersetzt werden können.
Professoren wie Peter Plavchan an der George Mason University berichten, dass Studierende oft mit hunderten oder gar tausenden ungeordneten Dateien auf ihrem Desktop arbeiten, was nicht nur ineffizient ist, sondern auch zu Fehlern in Forschungsprojekten führen kann. Die Erklärung und Einführung in die Prinzipien von Verzeichnissen, Datei-Extensionen, der Nutzung von Terminals und Kommandozeilen sowie die Organisation von Dateien ist für Lehrende mittlerweile zu einem festen Bestandteil ihrer Curricula geworden. In manchen Fällen nehmen derartige Grundlagen noch einen bedeutenden Teil der Lehrzeit ein, da ohne ein solides Verständnis dieser Konzepte die darauf aufbauenden komplexeren Anwendungen für Studierende kaum verständlich sind. Doch das Erklären dieser vermeintlich fundamentalen Konzepte gestaltet sich oft schwieriger als gedacht. Die Referenten stehen hier oft vor einem Generationen-Gap, weil die Denkweise der Studierenden stark von der bisher etablierten Mentalität abweicht.
Viele Schmiedungen und Metaphern, wie das „Hervorholen einer Akte aus einem Schrank“ oder das „Navigieren durch einen Baum“ als Erklärung für Ordnerstrukturen, greifen nur bedingt. Das Bild des „Wäschekorbs“, in dem alle Kleidungsstücke willkürlich liegen und auf Abruf vom „Roboter“ herausgeholt werden, wird von einigen als treffender und moderner angesehen. Ein Bild, das direkt die Rolle von Suchfunktionen und Automatisierung widerspiegelt. Trotz aller Anpassungen der Lehrmethoden bleibt eine Definitivantwort schwierig. Die Technologie und das Nutzerverhalten wandeln sich rasend schnell – Funktionen, die heute noch als unerlässlich gelten, können morgen veraltet sein.
Einige Pädagogen wie Plavchan vermuten, dass zukünftige Generationen und damit auch künftige Lehrkräfte mit völlig neuen Systemen arbeiten werden, die heutigen Ansätzen der Datei- und Ordnerverwaltung diametral entgegengesetzt sein könnten. In dieser Situation lautet ein wichtiger Ratschlag für Lehrende wie auch für die Bildungseinrichtungen selbst, die Veränderungen nicht zu ignorieren, sondern anzunehmen und in den Unterricht zu integrieren. Das bedeutet, einerseits digitale Grundkompetenzen weiterhin zu vermitteln, andererseits aber auch neue Arten der Informationsorganisation, suchbasierte Zugänge und Komfortfunktionen der modernen Nutzererfahrung ernst zu nehmen und zu verstehen. Darüber hinaus bietet sich die Chance, Studierende in ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit abzuholen und die digitalen Tools, die sie bevorzugen, mit den notwendigen technischen Grundlagen zu verknüpfen. So entsteht ein praxisnahes Lernumfeld, das den Übergang von der gewohnten App-basierten Recherche zu den technischen Anforderungen wissenschaftlicher Arbeit erleichtert.