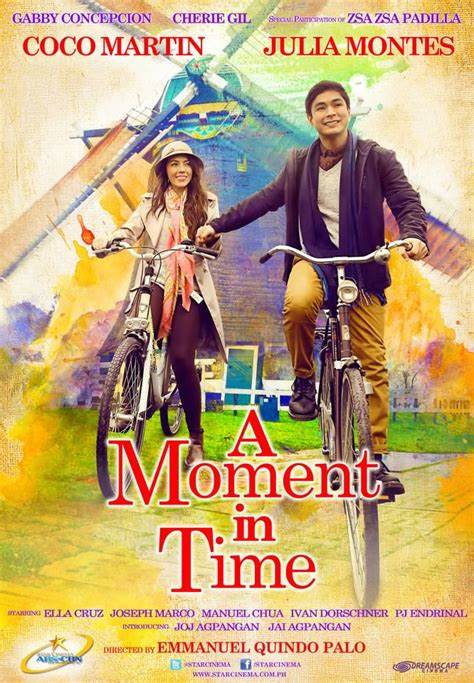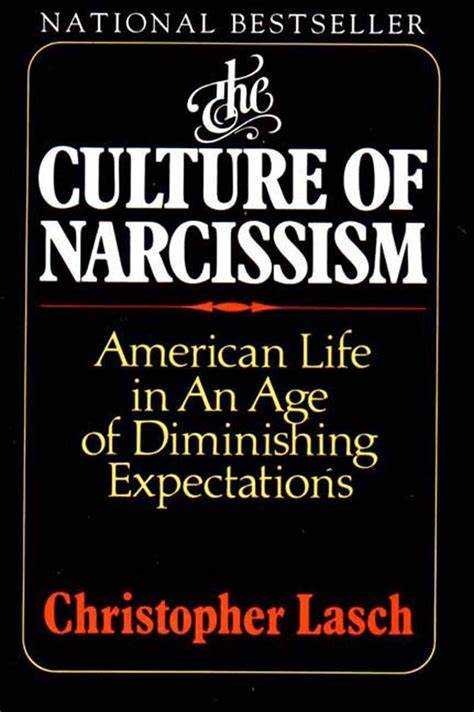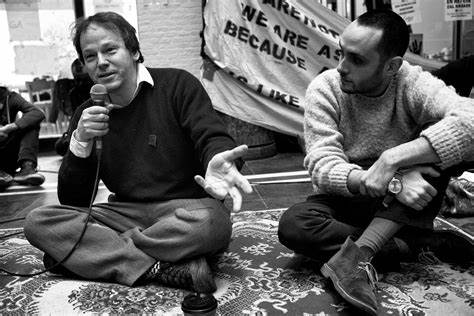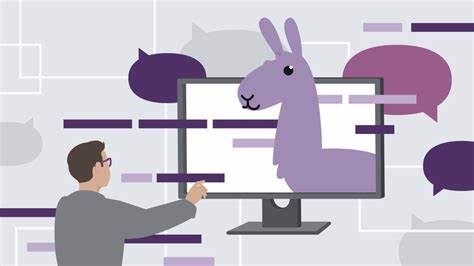Der Mount Everest, mit seinen 8.848 Metern der höchste Berg der Welt, stellt seit Jahrzehnten ein Symbol für Faszination, Abenteuer und menschliche Grenzerfahrungen dar. Traditionell benötigen Bergsteiger, um den Gipfel zu erreichen, mehrere Wochen bis Monate, um eine sichere Akklimatisierung an die extremen Höhenbedingungen zu gewährleisten. Nun plant eine kommerzielle Expeditionsfirma, den Aufstieg mithilfe von Xenongas in nur einer Woche zu bewältigen – ein Vorhaben, das weltweit für Aufmerksamkeit, Skepsis und kontroverse Diskussionen sorgt. Die Akklimatisierung ist ein entscheidender Faktor beim Bergsteigen auf extremen Höhen.
Aufgrund des sinkenden Sauerstoffpartialdrucks atmet der menschliche Körper in großer Höhe deutlich weniger Sauerstoff ein. Schon in Höhen rund um 5.500 Meter sind nur etwa halb so viele Sauerstoffmoleküle verfügbar wie auf Meereshöhe. Am Gipfel des Everest ist die Sauerstoffmenge sogar nur noch ungefähr ein Drittel der normalen Konzentration. Diese Sauerstoffarmut führt zu innerer Belastung für Herz, Lunge und Gehirn und kann ohne entsprechende Anpassung lebensgefährliche Folgen wie Hirn- oder Lungenödem nach sich ziehen.
Traditionell verlängern Bergsteiger deshalb die Zeit am Berg, indem sie mehrere Wochen in Höhe verbringen und durch wiederholtes Auf- und Absteigen den Körper langsam an den Sauerstoffmangel anpassen. Während dieser Akklimatisierungsphase produziert der Körper vermehrt Erythropoetin (EPO), ein Protein, das die Bildung roter Blutkörperchen anregt. Die Zunahme an roten Blutkörperchen erhöht die Sauerstofftransportkapazität des Bluts und verbessert so die Leistungsfähigkeit in sauerstoffarmer Umgebung. Hier setzt die neue Idee an: Durch die kontrollierte Inhalation von Xenongas soll die körpereigene Produktion von EPO stimuliert werden, ohne dass monatelange Aufenthalte in großen Höhen notwendig sind. Xenon ist ein Edelgas, das unter anderem als Narkosemittel eingesetzt wird.
Studien haben gezeigt, dass Xenon die EPO-Produktion innerhalb von Stunden nach der Anwendung erhöhen kann – ein Effekt, den man sich für die Vorbereitung auf Höhenextreme zunutze machen möchte. Die commercialisierte Umsetzung dieses Konzepts auf den Mount Everest wird derzeit von der österreichischen Firma Furtenbach Adventures vorangetrieben. Ihr Expeditionsleiter Lukas Furtenbach will seine Kunden mithilfe von Xenon so vorbereiten, dass sie ohne die traditionelle wochenlange Akklimatisierung und über nur sieben Tage den Gipfel erreichen können. Der Plan sieht vor, dass die Teilnehmer direkt von Europa nach Nepal reisen, von dort mit dem Hubschrauber zum Everest-Basislager fliegen und in kürzester Zeit aufsteigen – bei einem Preis von etwa 150.000 Euro pro Person.
Der Ansatz verspricht ein großes Plus an Sicherheit durch die wesentlich kürzere Verweildauer in der sogenannten Todeszone über 8.000 Metern. In diesen extremen Höhen verschlechtert sich der Gesundheitszustand der Bergsteiger rasch, und das Risiko von Unfällen, Wetterumschwüngen und Höhenkrankheiten steigt exponentiell. Je kürzer der Aufenthalt in dieser riskanten Zone, desto geringer sind potenziell lebensgefährliche Gefahren. Doch die Euphorie über diese potenzielle Revolution beim Bergsteigen wird von Experten aus Medizin und Alpinismus kritisch betrachtet.
Es gibt bislang kaum unabhängige wissenschaftliche Studien, die belegen, dass die Inhalation von Xenon tatsächlich in so kurzer Zeit die roten Blutkörperchen in ausreichendem Maße erhöht, um den dramatisch reduzierten Sauerstoff auf dem Everest auszugleichen. Zudem ist EPO als Wirkstoff in sportlichen Wettkämpfen verboten, da künstlich gesteigerte EPO-Werte das Risiko von Blutgerinnseln und dadurch verbundenen Herzinfarkten oder Schlaganfällen erhöhen können. Zwar wird Xenon in niedrigen Dosen bei dieser Methode sorgfältig dosiert, doch Langzeitstudien zur Sicherheit an extremen Höhen fehlen. Darüber hinaus mahnen Mediziner zur Vorsicht, wenn ein Narkosegas in einer Umgebung genutzt wird, die ohnehin die kognitive Leistungsfähigkeit durch Sauerstoffmangel beeinträchtigt. Schon leichte Sedierungseffekte können in der hochgefährlichen Bergwelt fatale Folgen haben, wenn schnelle Entscheidungen und präzises Handeln gefragt sind.
Neben medizinischen Bedenken gibt es auch ethische Diskussionen über die Verwendung solcher Substanzen im Bergsport. Während Medikamente zur Akklimatisierung, beispielsweise Acetazolamid, inzwischen weit verbreitet und akzeptiert sind, wird Xenon als leistungssteigernde „Abkürzung“ von vielen traditionellen Bergsteigern skeptisch betrachtet. Das Bergsteigen nach den Prinzipien der „reinen“ Kunst des Kletterns sei ohne technische Hilfsmittel und „Doping“ erstrebenswert. Trotzdem bleibt das Bedürfnis nach sichereren und effizienteren Methoden, den Everest zu besteigen, groß. Unzählige Menschen aus aller Welt möchten das Abenteuer bezwingen, doch der Berg hat eine beachtliche Todesstatistik.
Durch die zunehmende Anzahl an Touristen und kommerziellen Expeditionen steigen auch die Risiken auf der oft überfüllten Route. Xenon als neuartiger Akklimatisierungshelfer könnte, sofern sich der Effekt bestätigt, zu einer bedeutenden Innovation werden. Untersuchungen, wie sie zwischen 2020 und 2025 von Furtenbach und seinem Team durchgeführt wurden, zeigen vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich der Steigerung von EPO-Spiegeln und verbesserter Sauerstoffsättigung während der Expeditionen auf hohen Bergen wie Aconcagua. Dennoch fehlen noch peer-reviewed Studien, die die Effektivität und Sicherheit im größeren Maßstab belegen. Auch etablierte Wissenschaftler im Bereich der Höhenmedizin bleiben skeptisch.
Laut Professor Andrew Peacock von der Universität Glasgow reicht eine Steigerung des EPO-Spiegels allein nicht aus, um in wenigen Tagen die Anzahl roter Blutkörperchen signifikant zu erhöhen. Der Körper benötigt Zeit für die Erythropoese – den Prozess der Neubildung der Blutkörperchen. Ohne die traditionelle Akklimatisierung können schwere Höhenkrankheiten dennoch auftreten. Neben Xenon testen einige Bergsteiger und Forscher weiterhin pharmakologische Mittel wie Acetazolamid und Dexamethason, um akute Symptome zu lindern und die Anpassung zu erleichtern. Die Suche nach einer optimalen Kombination aus physiologischer Vorbereitung, Medikamenten und Technologie ist nach wie vor in vollem Gange.