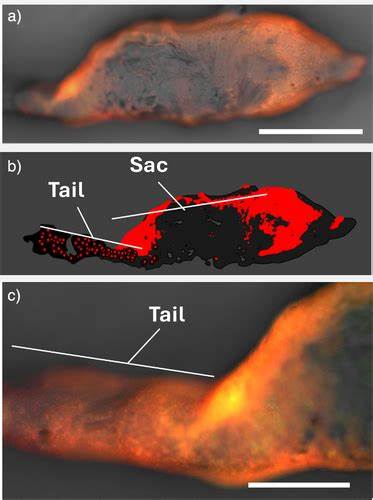Im Mai 2025 sorgte eine ungewöhnliche Entwicklung in der US-Regierung für Schlagzeilen: Das Department of Government Efficiency (DOGE), eine neue und umstrittene Behörde unter der Trump-Administration, suchte Zugang zur Government Accountability Office (GAO), einer der wichtigsten Kontrollinstanzen des Kongresses. Die GAO lehnte diesen Versuch jedoch ab und verwies auf ihre Unabhängigkeit als gesetzgebende Institution, die keiner Exekutivanweisung unterliegt. Dieses Ereignis steht stellvertretend für tiefgreifende Spannungen zwischen den Zweigen der amerikanischen Bundesregierung und ist von großer Bedeutung für das Verständnis der Gewaltenteilung sowie der Kontrolle staatlicher Macht. Das DOGE wurde im Januar 2025 durch eine Executive Order des Präsidenten ins Leben gerufen und verfolgt das erklärte Ziel, Effizienzsteigerungen in der Bundesregierung voranzutreiben. Als „nicht ministeriales Ministerium“ soll DOGE modernisierte Managementpraktiken und eine straffere Kontrolle etablieren.
Allerdings stößt die Behörde aufgrund ihrer weitreichenden Eingriffsbefugnisse und der zentralen Steuerungsfunktion auf erheblichen Widerstand, vor allem bei Einrichtungen, deren Unabhängigkeit traditionell als unverzichtbar gilt – darunter auch die GAO. Die GAO fungiert als unabhängige, unparteiische Einrichtung, die direkt für den Kongress arbeitet und eine zentrale Kontrollfunktion über die Verwendung öffentlicher Mittel und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ausübt. Als Teil der Legislative unterliegt sie nicht den Weisungen der Exekutive und steht somit in einer verfassungsmäßig etablierten Gewaltenteilung außerhalb der direkten Kontrolle der Regierung. Dies macht den Status der GAO besonders wichtig, wenn es um den Schutz vor exekutivem Einfluss geht. Der Versuch von DOGE, ein Team zur GAO zu entsenden, wurde von der Government Accountability Office umgehend abgelehnt.
In einem offiziellen Schreiben betonte die GAO, dass sie als gesetzgebende Behörde weder DOGE noch den Exekutivanordnungen unterliegt. Die klar formulierte Absage verdeutlicht nicht nur die institutionelle Selbstbehauptung der GAO, sondern auch die sensitivem Balance, die zwischen den Regierungszweigen bestehen muss, um eine gesunde Demokratie zu gewährleisten. Politisch löste die Affäre heftige Reaktionen aus. Vertreter der oppositionellen Parteien, insbesondere der ranghöchste Demokrat im House Oversight Committee, Rep. Gerry Connolly, bezeichneten den Vorstoß von DOGE als „direkten Angriff auf die heilige Gewaltenteilung unserer Nation“.
Durch solche Maßnahmen werde versucht, die gewachsenen Schutzmauern der unabhängigen Kontrollorgane zu unterwandern und die Legislative einer exekutiven Kontrolle zu unterwerfen. Die Einbindung der GAO in den „Kampf“ um DOGE reflektiert eine breitere politische Dynamik, die sich seit Amtsantritt der neuen Regierung zeigt. Der Versuch, zentralisierte Kontrolle über mehrere traditionelle Institutionen des kongressialen Apparats zu erlangen, steht im Kontext eines umfassenderen Bestrebens der Exekutive zur Reform und Straffung des Regierungsapparats. Dabei geraten aber fundamentale Grundsätze der Gewaltenteilung in Gefahr, was nicht nur juristische, sondern auch demokratiepolitische Fragen aufwirft. Historisch gesehen wurde die GAO bereits 1921 gegründet, um dem Kongress ein unparteiisches Instrument an die Hand zu geben, mit dem öffentliche Ausgaben und Verwaltungshandeln überprüft werden können.
Die Position des Comptroller General, der die GAO leitet, wird zwar vom Präsidenten nominert, erfolgt jedoch ausschließlich nach Beratung und Zustimmung des Senats, was für die institutionelle Unabhängigkeit von großer Bedeutung ist. Zudem schlägt ein Kongressausschuss Kandidaten vor, was weitere legislative Kontrolle sichert. Der derzeitige Comptroller General, Gene Dodaro, ist ein erfahrener Beamter und seit 2008 im Amt. Seine Führung hat die GAO als zuverlässige Quelle für die Gesetzgebung und Kontrolle in vielen komplexen Themenbereichen etabliert. Der Widerstand gegen DOGE kann auch als Ausdruck des Bestrebens angesehen werden, die lange gewachsene institutionelle Integrität zu wahren.
Rechtlich basieren die Argumente der GAO darauf, dass Exekutivverordnungen grundsätzlich für Behörden und Institutionen der Exekutive bindend sind, nicht jedoch für gesetzgebende Organe. DOGE hingegen sieht sich in einer Position, bundesweite Effizienzmaßnahmen zentral zu koordinieren und möchte auf diesem Wege auch die GAO durch personelle Zuweisungen einbinden. Dieser Konflikt hat somit das Potenzial, vor Gericht oder dem Kongress als politische Bühne weiter ausgetragen zu werden und könnte Präzedenzcharakter bei der Frage der Reichweite exekutiver Befugnisse erlangen. Die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit, die dieser Vorstoß von DOGE verursachte, brachte somit nicht nur interne Regierungsstrukturen sondern auch das Prinzip der Gewaltenteilung wieder in den Fokus der Debatte. Gleichzeitig zeigt sich an diesem Beispiel, wie neue Regierungsinitiativen schnell an bestehende und bewährte institutionelle Gleichgewichte stoßen und diese herausfordern können.
Aus Sicht von Verfassungsrechtsexperten ist es von entscheidender Bedeutung, dass solche Eingriffe in die Unabhängigkeit der Kontrolleinrichtungen sorgfältig geprüft und gegebenenfalls überprüft werden, um eine Verschränkung und Verfälschung der Machtverhältnisse zu verhindern. Die Rolle der GAO als unparteiischer Prüfer wird als essenziell angesehen, damit der Kongress seine Kontrollfunktion über die Exekutive wahrnehmen kann. Interessant ist zudem die Reaktion der eingesetzten Vertreter von DOGE, die nach Erhalt des Ablehnungsschreibens der GAO laut Medienberichten die Angelegenheit als „abgeschlossen“ betrachteten. Dieses Einlenken könnte auf eine taktische Rücknahme hindeuten oder auf die Erkenntnis, dass der politische und juristische Widerstand gegen den Vorstoß zu groß ist. Gleichzeitig bleibt unklar, welche zukünftigen Versuche es geben wird, die Kontrolle über legislative Einrichtungen auszuweiten.
Die Debatte zeigt auch, wie wichtig professionelle und unparteiische Institutionen sind, die trotz politischer Umwälzungen eine konstante Steuerungs- und Kontrollfunktion über die Verwaltung und das öffentliche Handeln gewährleisten. GAO steht dabei als Sinnbild für eine umsichtige und unabhängige Kontrolle, ohne die eine Demokratie untergraben werden könnte. Diese Entwicklungen werfen nicht nur ein Schlaglicht auf die gegenwärtige politische Situation unter der Trump-Führung, sondern betreffen die grundsätzliche Frage, wie Macht zwischen den einzelnen Zweigen der US-Regierung verteilt ist und wie diese durchgesetzt, respektiert und geschützt wird. Im Kern handelt es sich um die Bewahrung der Gewaltenteilung, die als Fundament funktionierender Demokratien gilt. Die Konsequenzen aus dem Widerstand von GAO gegen den Zugriff von DOGE könnten weitreichend sein.