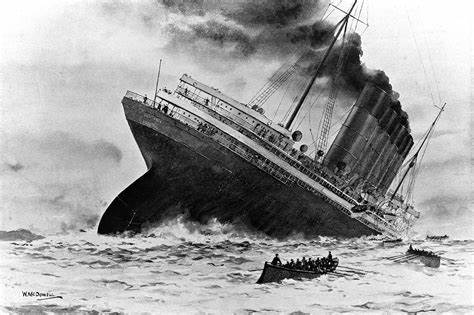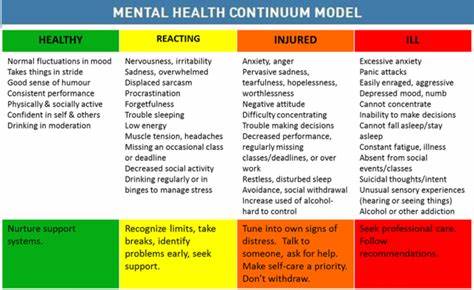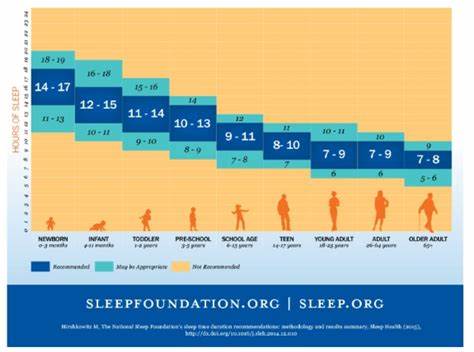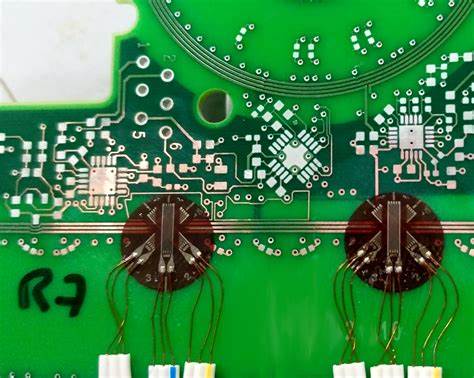Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sah sich der US-Bundesstaat Idaho mit einem unerwarteten Problem konfrontiert: Eine wachsende Anzahl von Beschwerden über den Schaden, den Biber an Häusern und landwirtschaftlichen Flächen verursachten. Gleichzeitig war dem Idaho Department of Fish and Game aber auch die enorme ökologische Bedeutung der Biber für das regionale Ökosystem bewusst. Die Tiere leisten wertvolle Dienste, indem sie den Boden vor Erosion schützen, den Wasserhaushalt regulieren und Lebensräume für zahlreiche Vogel- und Fischarten schaffen. Doch die zunehmende Siedlungstätigkeit und das damit verbundene Konfliktpotenzial zwangen die Behörden zu einer originellen Lösung, die noch heute Menschen weltweit fasziniert – dem sogenannte „Beaver Drop“. Die Geschichte begann vor dem Hintergrund einer stark rückläufigen Bieberpopulation.
Jahrzehntelang waren Biber wegen ihres begehrten Fells intensiv bejagt worden, was ihr Vorkommen stark dezimierte. Schon in den 1930er Jahren starteten die amerikanischen Behörden erste Umsiedlungsprogramme, bei denen Biber auf dem Landweg in geeignetere, naturbelassene Gebiete transportiert wurden. Doch diese Methode war langwierig, kostspielig und mit hohen Ausfallraten verbunden. Die Tiere litten unter Stress, Überhitzung und Verletzungen während der aufwendigen Fahrt über steile Hänge, schlechte Straßen und weite Strecken. Die Idee, Biber mit dem Flugzeug umzusetzen und sie unter Nutzung von Fallschirmen abzuwerfen, kam 1948 vom Idahoer Mitarbeiter Elmo W.
Heter. Er griff auf die Ressourcen der gerade erst zu Ende gegangenen Kriegszeit zurück und nutzte übrig gebliebene Fallschirme des Zweiten Weltkriegs. Zusammen mit speziell konstruierten Holzkisten mit Belüftungslöchern entwickelte er eine Art Transporteinheit, die sicher vom Flugzeug abgeworfen werden konnte und sich beim Aufprall automatisch öffnete. Zwei Biber wurden jeweils in eine dieser halbschuhkartongroßen Boxen gesetzt, die sich beim Landen wie ein Koffer mit einem Federmechanismus öffneten, um den Tieren eine schnelle Flucht zu ermöglichen. Der Transportziel war das entlegene Chamberlain Basin in der Sawtooth Mountain Range, das im zentralen Idaho liegt und optimale Lebensbedingungen für Biber bot.
Für die Tiere bedeutete der Umzug ein neues Zuhause fernab von besiedelten Gebieten, wo sie ihre natürlichen Verhaltensweisen entfalten konnten, ohne Mensch und Eigentum zu gefährden. Am 14. August 1948 startete das Abenteuer. Ein zweimotoriges Beechcraft-Flugzeug hob mit acht solcher „Biberkisten“ ab, begleitet von einem Piloten und einem Tierschutzbeauftragten. Die Flugrichtung führte vom Westen Idahos ins zentrale Bergland.
Der Flug erfolgte in Höhen zwischen 150 und 240 Metern – eine ideale Höhe, um genügend Zeit für den Fallschirmabwurf zu haben und gleichzeitig das Risiko für die Biber gering zu halten. Innerhalb weniger Tage konnten 76 Biber so umgesiedelt werden, von denen 75 die Prozedur überlebten. Die einzige bekannte Todesursache lag bei einem Biber, der aus der Box entkam, ehe sie landete, und dann abstürzte. Bereits kurz nach der Aktion galt das Projekt als großer Erfolg. Die Tiere siedelten sich an, bauten Dämme und trugen zur ökologischen Stabilität der Region bei.
Neben dem natürlichen Nutzen beeindruckte die kreative Vorgehensweise auch Wissenschaftler, Naturschützer und die Öffentlichkeit. In Popular Mechanics, einem renommierten Technik- und Wissenschaftsmagazin, wurde die Aktion 1949 ausführlich porträtiert. Dort erhielten die gepanzerten Beuteltiere sogar den Spitznamen „Parabeavers“. Das Projekt trug dazu bei, den Blick auf den Wert und die Bedeutung des Bibers als Schlüsselart in den nordamerikanischen Feuchtgebieten zu schärfen. Die Technik der Fallschirmumsiedlung wurde später nicht mehr praktiziert, da die Ziele größtenteils erreicht wurden und alternative Umsiedlungsmethoden effizienter oder praktikabler erschienen.
Dennoch blieb der „Beaver Drop“ als ein Paradebeispiel für unkonventionellen Naturschutz in Erinnerung und wurde im Laufe der Jahre immer wieder durch neue Forschungen und historische Aufarbeitung belebt. Die Wiederentdeckung der Originalaufnahmen aus den Beweisfilmen durch den Idaho State Historical Society im Jahr 2015 sorgte weltweit für Aufsehen. Das Video zeigte authentisch den Vorgang des Abwurfs und das Funktionieren der ausgeklügelten Boxen. In sozialen Medien avancierte der „parachuting beaver“ zum viralen Hit und weckte erneut das Interesse an den ökologischen Leistungen der Biber sowie an kreativen Umweltschutzprojekten. Heute ist der „Beaver Drop“ nicht nur ein Kuriosum der Tierumsiedlung, sondern auch ein Symbol für pragmatischen und innovativen Naturschutz.
Er erinnert daran, dass selbst niederige Herausforderungen wie die Umsiedlung von Bibern durch clevere Nutzung existierender Technologien und den Mut, ungewöhnliche Wege zu gehen, erfolgreich bewältigt werden können. Der Bieber als „Ökosystem-Ingenieur“ bleibt ein wesentlicher Baustein für gesunde Feuchtgebiete – auch wenn heute andere Methoden als die überraschende Luftrettung zum Einsatz kommen. Die nachhaltigen Lektionen des Projekts zeigen, dass das Zusammenspiel von Mensch, Tier und Natur eine Balance finden kann, die allen Beteiligten nutzt. Der „Beaver Drop“ hatte ebenso einen hohen kulturellen Wert für Idaho und inspirierte bis heute kreative Ideen in Sachen Tierumsiedlung und Naturschutz. Abschließend lässt sich sagen, dass der musikalische Ruf dieser Fallschirm-bewehrten Biber weit über die Grenzen Idahos hinausreicht und sie zu einer einzigartigen Ikone in der Geschichte des Naturschutzes geworden sind.
Die Kombination aus technischem Einfallsreichtum, tierischem Überlebenswillen und ökologischer Wirksamkeit macht den Beaver Drop auch heute noch zu einer faszinierenden Geschichte, die Optimismus und Ideenreichtum in der Umweltpolitik vermittelt. Die Biber springen zwar schon lange nicht mehr im Pazifik nordamerikanischer Flugzeuge aus der Luft, doch sie leisten weiterhin ihren wertvollen Beitrag zu einer gesunden Umwelt, geschützt durch engagierte Schutzmaßnahmen und ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen Mensch und Natur.