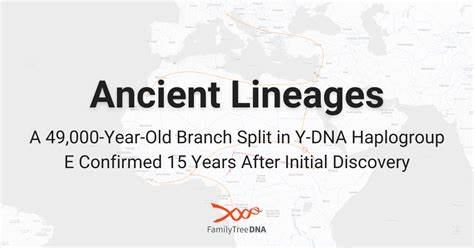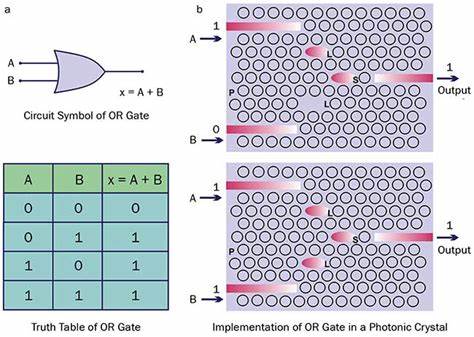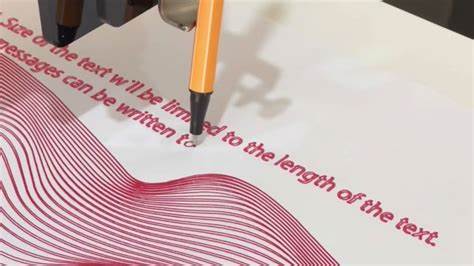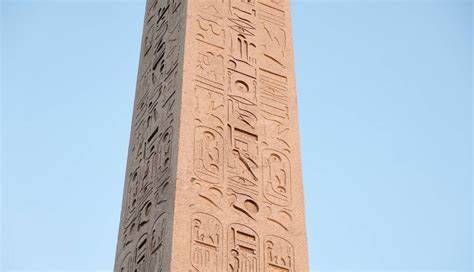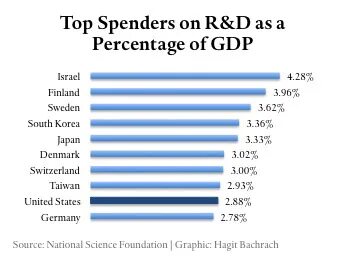Die Sahara, heute eine der größten und trockensten Wüstenregionen der Welt, war vor Tausenden von Jahren eine üppige und grüne Savannenlandschaft – bekannt als die Grüne Sahara oder African Humid Period (AHP). Diese Periode, die etwa von 14.500 bis 5.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung andauerte, veränderte das Gesicht Nordafrikas grundlegend, sorgte für ausgedehnte Wasserflächen, Seen und üppige Vegetation. Die klimatischen Bedingungen gaben den Menschen den nötigen Lebensraum und Ressourcen, um sich niederzulassen, zu jagen, zu sammeln und schließlich die Viehzucht zu entwickeln.
Erstmals erlauben genetische Analysen antiker DNA aus dieser Region einen durchdringenden Blick in die Bevölkerungsgeschichte und die genetische Herkunft der Menschen, die in dieser Zeit dort lebten. Besonders spannend sind neue Erkenntnisse aus der Takarkori-Felsensiedlung in Libyen, wo Überreste von vor etwa 7.000 Jahren lebenden Frauen ausgegraben wurden. Diese stellen den ersten genomweiten DNA-Nachweis aus dem zentralen Sahara-Gebiet dar – ein Gebiet, dessen genetische Archäologie bislang aufgrund klimatischer Herausforderungen weitgehend im Dunkeln lag. Die Analyse dieser DNA-Proben offenbart eine bislang unbekannte, tief verwurzelte nordafrikanische Abstammungslinie, die sich schon sehr früh – gemeinsam mit den Vorfahren heutiger Menschen außerhalb Afrikas – von sub-saharischen Populationen abgespalten hat.
Diese genetische Linie blieb für die meiste Zeit isoliert und unterscheidet sich deutlich von den heute weit verbreiteten afrikanischen und außereuropäischen Genomprofilen. Die Takarkori-Individuen sind eng verwandt mit den etwa 15.000 Jahre alten Jägern und Sammlern aus der Taforalt-Höhle im heutigen Marokko, deren genetische Charakteristik mittlerweile gut dokumentiert ist. Die Gemeinsamkeit verweist auf eine lange bestehende und stabile Population in Nordafrika, die vor dem Beginn der African Humid Period existierte und sich über große Teile des nördlichen Afrika erstreckte. Die genetische Lücke zu sub-saharischen Populationen ist dabei bemerkenswert.
Die Untersuchungen zeigen kaum Zeichen von genetischem Austausch zwischen diesen Gruppen und jenen, die den zentralen und nördlichen Teil der Sahara bewohnten, trotz der vegetationsreichen Phase, die theoretisch den Wanderverkehr zwischen den Regionen hätte erleichtern können. Diese Beobachtung legt nahe, dass ökologische, geographische und kulturelle Barrieren den genetischen Fluss über die Grüne Sahara weiterhin begrenzten. Selbst in einer Zeit, in der Landschaften und Ressourcen für Menschen vergleichsweise günstig waren, verhinderten diese Faktoren offenbar eine größere Durchmischung. Ein wesentliches Ergebnis der Studie ist die Art und Weise, wie der Übergang zur Pastoralisierung in der Sahara stattgefunden hat. Anders als vorherige Hypothesen, die von einer signifikanten Wanderung von herdführenden Gruppen aus dem Nahen Osten ausgingen, deuten die genetischen Daten auf eine Mehrheit lokaler Herkunft der grünen Sahara-Bevölkerung hin.
Die Ausbreitung von Viehzuchttechniken erfolgte demnach eher durch kulturellen Austausch und Nachahmung als durch großflächige Bevölkerungsbewegungen – ein Prozess, der als kulturelle Diffusion bezeichnet wird. Das bedeutet, dass indigene Gruppen der Sahara die neuen Techniken adaptieren konnten, ohne dass eine plausibel erkennbare genetische Vermischung mit Levante-Populationen stattfand. Die genetische Untersuchung ergab darüber hinaus Hinweise auf eine sehr geringe Neandertaler-Anteile in den Takarkori-DNA-Proben. Neandertaler-Erbgut ist in allen nicht-afrikanischen Populationen präsent und ist ein Ergebnis von Interaktionen zwischen frühen modernen Menschen und Neandertalern außerhalb Afrikas. Die sehr niedrigen Mengen, die bei den Takarkori-Funden entdeckt wurden, bestätigen erneut, dass diese Population überwiegend afrikanischer Abstammung war, mit nur geringfügigem genetischem Material von Nicht-Afrikanern.
Somit ergibt sich ein Bild einer isolierten und eigenständigen nordafrikanischen Bevölkerungsgruppe, die trotz Kontaktspuren zum Nahen Osten genetisch einzigartig blieb. Interessanterweise spiegeln sich diese genetischen Befunde auch auf der Ebene der mitochondrialen DNA wider, einem Maternal-Linien-Marker. Die Takarkori-Frauen gehörten zu einer sehr alten und basal positionierten N-Haplogruppe, die eine der tiefsten außerhalb von Sub-Sahara-Afrika darstellt und damit wichtige Hinweise auf frühe menschliche Migrationen und Populationsteilungen liefert. Diese Ergebnisse bleiben spannend für die Diskussion zur Bevölkerungsstruktur während des späten Pleistozäns und des frühen Holozäns in Nordafrika. Ein weiteres faszinierendes Ergebnis der Studienarbeit war die genetische Beziehung zu zeitgleichen und späteren Bevölkerungen.
Die Takarkori-Individuen teilen eine erhebliche genetische Nähe mit den Fulani-Pastoralisten heutiger Tage, die in den Sahelgebiet verstreut sind. Dies legt nahe, dass es eine genetische Kontinuität beziehungsweise bedeutende genetische Beiträge von Populationen der Grünen Sahara zu heutigen Sahelianern und Teilen Westafrikas gibt. Der genetische Fußabdruck der Grünen Sahara war somit auch für spätere Bevölkerungen von Wichtigkeit und könnte Hinweise zu migrationsgeschichtlichen Verbindungen zwischen Nord- und Westafrika geben. Darüber hinaus konnte mit segítség der weitreichenden genetischen Modellierungen und Vergleiche die Herkunft der sogenannten „sub-saharischen“ Komponente im Taforalt-Genom neu bewertet werden. Während bisher angenommen wurde, dass diese Komponente aus dem Süden Afrikas stamme oder breit auf verschiedene Regionen verteilt sei, ergab die Einbindung der Takarkori-DNA eine deutlich präzisere Zuordnung: Der „sub-saharische“ Anteil in Taforalt besteht vielmehr aus einer nordafrikanischen Abstammung, vergleichbar der Linie, die die Takarkori-Populationen repräsentieren.
Zusammen mit einem Anteil von ungefähr 60 Prozent aus einer Nahost-Population namens Natufier schlichtet sich die Geschichte Nordafrikas als komplexe Mischung lokaler und nahöstlicher genetischer Quellen. Geographisch markiert der Fundort Takarkori in Libyen eine bedeutende Kulturstätte im Tadrart Acacus-Gebirge. Hier wurden neben Skelettfunden auch Artefakte wie Keramik, Werkzeuge und Felskunst entdeckt, die lebendige Zeugen der damaligen Kultur und Lebensweise sind. Sie geben Einblick in die ausgeprägte soziale Organisation, Subsistenzstrategien und die Entwicklung der Viehzucht im Grünen Sahara-Kontext. Die erzwungene Isolation der Takarkori-Gruppe – möglicherweise bedingt durch ökologische Fragmentierung, kulturelle Spezialisierungen und begrenzte Bevölkerungsgröße – hat möglicherweise das langfristige Überleben dieser einzigartigen genetischen Linie im nördlichen Afrika ermöglicht.
In Verbindung mit den klimatischen Umbrüchen am Ende des African Humid Period führte dies jedoch wohl zu einer weiteren Verschiebung der Populationen und späteren genetischen Zusammensetzungen, die Afrika bis zur Neuzeit prägten. Insgesamt erweitern diese Erkenntnisse das Verständnis der prähistorischen Bevölkerungsdynamik Afrikas erheblich. Sie werfen ein neues Licht auf die Art und Weise, wie Menschen in einer der anspruchsvollsten Umgebungen lebten, wie kulturelle Innovationen sich verbreiteten und wie genetische Diversität erhalten oder verändert wurde. Die Betonung kultureller Diffusion gegenüber grossangelegten Migrationen verschiebt den Fokus in zukünftigen archäogenetischen Forschungen auf die komplexen Wechselwirkungen zwischen Kultur und Genetik in Urgesellschaften. Zukünftige Forschung wird voraussichtlich noch mehr Licht auf bislang unbekannte Genlinien Nordafrikas und deren Bedeutung für die menschliche Frühgeschichte werfen.
Mit weiter sinkenden Kosten und verbesserten Technologien der DNA-Sequenzierung können hoffentlich bald auch niedrig konservierte Proben aus anderen Teilen der Sahara oder des afrikanischen Kontinents analysiert werden. Diese könnten weitere Puzzleteile zu einem differenzierten Bild menschlicher Besiedlung, sozialer Traditionen und Umweltanpassungen beitragen. Die Ergebnisse aus Takarkori tragen darüber hinaus zu einer überregionalen Diskussion bei, inwiefern die Sahara als Barriere oder Brücke zwischen Afrika und Eurasien fungierte. Die Erkenntnisse deuten an, dass die Sahara trotz intermittierender grüner Phasen überwiegend eine genetische und kulturelle Grenze darstellte, die Populationen über Jahrtausende voneinander separierte. Dies reflektiert auch die heutige genetische Vielfalt und Struktur Afrikas, die sich aus einer Vielzahl alter, isolierter und dynamisch interagierender Populationen ableitet.
Abschließend bringen die genomischen Daten aus der Grünen Sahara einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis der menschlichen Evolution und Kulturentwicklung in Nordafrika. Sie bestätigen eine tief verwurzelte nordafrikanische Abstammungslinie, erläutern die Rolle kultureller Diffusion bei der Aufnahme neuer Lebensweisen und verdeutlichen den Stellenwert der Sahara als komplexer Lebensraum mit bemerkenswerter genetischer Geschichte. Diese Forschung unterstreicht die Bedeutung archäogenetischer Ansätze für die Rekonstruktion prähistorischer Gesellschaften und öffnet Türen für spannende zukünftige Entdeckungen.