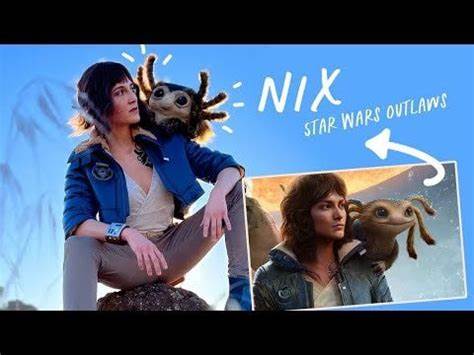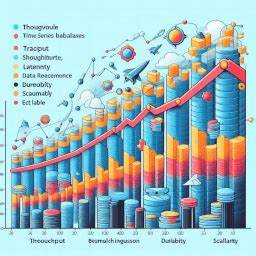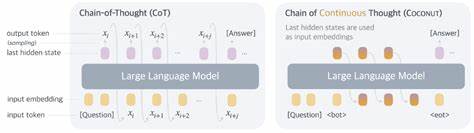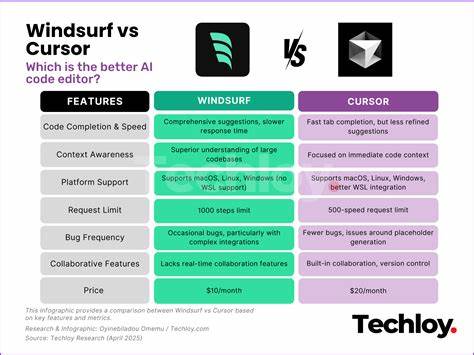Digitale Dienste sind heute das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie prägen, wie wir einkaufen, Geld verwalten, kommunizieren oder lernen. Doch in einer zunehmend digitalisierten Welt ist Vertrauen unerlässlich. Gerade deshalb hat Craftzing den Digital Trust Index ins Leben gerufen, um zu messen, wie vertrauenswürdig und inklusiv europäische Websites wirklich sind. Angesichts der Einführung des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes (European Accessibility Act, EAA) am 28.
Juni 2025 stellt sich eine entscheidende Frage: Wie barrierefrei ist das Web heute und sind Unternehmen und Organisationen in Europa für die Anforderungen von morgen gewappnet? Der Digital Trust Index 2025 liefert belastbare und erschreckende Antworten auf diese Frage und zeigt eindrücklich, wie groß der Handlungsbedarf weiterhin ist. Die Ergebnisse der Erhebung werfen ein ernüchterndes Bild auf die digitale Zugänglichkeit in Europa. Insgesamt wurden 266.000 europäische Startseiten aus 18 Ländern auf Barrierefreiheit geprüft. Von diesen erfüllten gerade einmal 7 Prozent die definierten Kriterien, was bedeutet, dass 93 Prozent der getesteten Webseiten mindestens einen Barrierefreiheits-Fehler enthielten.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Situation nur minimal verbessert, mit einer Verbesserung von weniger als einem Prozent. Das zeigt, dass trotz intensiver Bemühungen der Fortschritt in diesem Bereich schleppend verläuft. Besonders auffällig ist, dass alle getesteten Länder schlechte Werte aufweisen, wenn es um digitale Barrierefreiheit geht. Am besten schneidet die nordische Region mit Norwegen, Finnland und Schweden ab, gefolgt von Belgien, das es gerade noch unter die Top-Fünf geschafft hat. Am unteren Ende des Spektrums finden sich Länder wie die Slowakei, Rumänien und Ungarn.
Der Index berücksichtigt neben Länderunterschieden auch die Analyse verschiedener Wirtschaftszweige. Der öffentliche Sektor erreicht dabei die höchsten Werte und übertrifft den Durchschnitt der anderen Kategorien um rund zehn Prozent. Dies kann unter anderem auf die oftmals strengeren Vorschriften und das größere öffentliche Interesse an barrierefreien Dienstleistungen zurückgeführt werden. Am unteren Ende steht der Einzelhandel, der bis zu drei Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Gerade in diesem Bereich, der durch E-Commerce und digitale Verkaufsplattformen geprägt ist, gibt es erhebliche Defizite bezüglich Zugänglichkeit.
Typische Barrieren im Web zeigen sich in sehr konkreten und häufig auftretenden Problemen. So gehören niedriger Farbkontrast und schlecht unterscheidbare Links zu den am häufigsten festgestellten Mängeln. Fehlende oder unzureichende textliche Beschreibungen von Bildern (sogenannte Alt-Texte) erschweren Nutzern mit Sehbehinderungen die Orientierung auf der Seite erheblich. Ebenso fehlen vielfach klare Labels für Schaltflächen und Links, was besonders für Screenreader-Nutzer ein erhebliches Hindernis darstellt. Auch falsche Spracheinstellungen beeinträchtigen die Nutzung erheblich und können etwa zu Fehlinterpretationen oder unangemessener Sprachausgabe führen.
Diese Probleme sind zwar weit verbreitet, lassen sich aber mit vergleichsweise geringem Aufwand beheben, sofern Know-how und Bewusstsein vorhanden sind. Ein besonderes Augenmerk widmet der Digital Trust Index 2025 auch der Zugänglichkeit von KI-gestützten Chatbots, die in immer mehr europäischen Websites eingesetzt werden, um Nutzerfragen schnell und effizient zu beantworten. In einer ergänzenden Studie wurden 15 solcher Chatbots populärer belgischer Websites auf ihre Barrierefreiheit getestet. Nur zwei von ihnen bestanden alle Tests uneingeschränkt. Die häufigsten Probleme liegen hier in der fehlenden Tastaturbedienbarkeit und der mangelnden Kompatibilität mit Screenreadern.
Ohne sichtbare Fokusindikatoren ist die Navigation per Tastatur oder alternative Hilfsmittel erheblich erschwert. Farbkontrastprobleme und unzureichende Skalierbarkeit bei der Vergrößerung von Text erschweren zudem die Nutzung zusätzlich. Diese negativen Ergebnisse zeigen, dass auch moderne, technologisch hochentwickelte Lösungen wie Chatbots häufig nicht barrierefrei gestaltet sind. Die Bedeutung von digitaler Barrierefreiheit geht dabei weit über die reine Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hinaus. Über 100 Millionen Europäerinnen und Europäer leben mit einer Behinderung.
Das entspricht etwa jedem vierten Erwachsenen. Die Herausforderungen reichen von Mobilitäts- und Seheinschränkungen über Hör- und kognitive Beeinträchtigungen bis hin zu temporären Einschränkungen. Digitale Barrierefreiheit ermöglicht diesen Menschen Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, Bildung, Gesundheitsversorgung und vielem mehr. Gelingt das nicht, führt dies zu sozialer Ausgrenzung, Frustration und oft auch wirtschaftlichen Nachteilen – sowohl für die Betroffenen als auch für die Anbieter digitaler Dienste. Mit der Umsetzung des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes ab Juni 2025 wird der Druck auf Organisationen und Unternehmen erheblich steigen.
Die Verordnung schreibt verbindliche Anforderungen vor, die für essenzielle Produkte und Dienstleistungen gelten. Dabei steht nicht nur die eigentliche Zugänglichkeit im Vordergrund, sondern auch die Schaffung vertrauenswürdiger digitaler Umgebungen für alle Nutzergruppen. Letzteres ist entscheidend, um das Potenzial des digitalen Wandels in vollem Umfang auszuschöpfen. Es drohen Bußgelder und rechtliche Konsequenzen für jene, die nicht fristgerecht nachbessern. Was bedeutet das für Unternehmen und Entwickler? Wesentlich ist, dass Barrierefreiheit nicht als nachträglicher Gedanke oder lästige Pflicht behandelt wird.
Vielmehr sollte sie integraler Bestandteil des gesamten Produktentwicklungsprozesses sein. Wer digital inklusive Angebote schaffen möchte, spart sich langfristig erhebliche Kosten und verbessert gleichzeitig die Nutzererfahrung aller Menschen. Der sogenannte „Curb-Cut-Effekt“ zeigt auf, dass beispielsweise Rampen für Rollstuhlfahrer nicht nur diesen Menschen dienen, sondern allgemein die Zugänglichkeit und Komfort für alle erhöhen. Ebenso profitieren viele Nutzer von kontrastreichen Texten, klar strukturierten Seiten oder alternativem Text für Bilder – sei es in lauten Umgebungen oder bei temporären Einschränkungen. Der Digital Trust Index macht daher auch deutlich, dass es nicht genügt, Barrierefreiheit lediglich zu berücksichtigen.
Sie muss von Anfang an, also vom Konzept bis hin zur Umsetzung und Wartung, systematisch in digitale Produkte und Services integriert werden. Dies schafft nicht nur Mehrwert für Menschen mit Behinderungen, sondern steigert auch das Ansehen und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen und Organisationen. In der Praxis bedeutet das, Arbeitsprozesse anzupassen, barrierefreie Standards wie die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) konsequent umzusetzen und digitales Design sowie Entwicklung barrierefrei zu gestalten. Zudem erfordert es ein Bewusstsein unter Entscheidungsträgern, Entwicklerteams und allen Beteiligten, dass Barrierefreiheit eine fundamentale Voraussetzung für eine inklusive und nachhaltige digitale Gesellschaft ist. Fazit: Der Digital Trust Index 2025 offenbart eine ernste und dringliche Lücke in der digitalen Barrierefreiheit Europas.
Trotz minimaler Fortschritte zeigt sich, dass ein umfassender Wandel unabdingbar ist, um alle Menschen gleichberechtigt am digitalen Leben teilhaben zu lassen und die Anforderungen der nahenden Gesetzgebung zu erfüllen. Unternehmen, Verwaltungen und alle digitalen Dienstleister sind in der Pflicht, Barrierefreiheit nicht als Compliance-Aufgabe, sondern als Chance für Innovation, Reichweite und Nutzerzufriedenheit zu begreifen. Die kommenden Monate bis zur Gültigkeit des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes bieten die Gelegenheit, unnötige Barrieren zu beseitigen und digitale Produkte auf ein neues Qualitätsniveau zu heben. Werden diese Chancen genutzt, steht einer vertrauensvollen und inklusiven digitalen Zukunft nichts im Wege.