In den letzten Jahren hat sich der Arbeitsmarkt insbesondere durch die verstärkte Möglichkeit des Remote-Arbeitens erheblich verändert. Unternehmen mussten sich an neue Anforderungen anpassen, während Arbeitnehmer weltweit von flexibleren Arbeitsmodellen profitieren konnten. Ein bemerkenswerter Trend, der sich insbesondere in den USA abzeichnet, ist jedoch die zunehmende Praxis vieler US-Unternehmen, Remote-Positionen ausschließlich für Arbeitnehmer mit Wohnsitz in den USA zu öffnen. Dieser Wandel wirft viele Fragen auf, insbesondere warum diese „US-only“ Einstellungspolitik so stark zunimmt und welche Faktoren hinter dieser Entwicklung stecken. Ein wesentlicher Grund liegt in den rechtlichen Rahmenbedingungen.
In den USA sind sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer verpflichtet, zahlreiche Regelungen des Arbeitsrechts, Steuerrechts sowie Sozialversicherungsbestimmungen einzuhalten. Wenn ein US-Unternehmen Mitarbeiter außerhalb der USA beschäftigt, ergeben sich schnell komplexe Herausforderungen. Dazu zählt zum Beispiel die Frage der Rechtssicherheit bezüglich des Arbeitsvertrags und der Einhaltung ausländischer Arbeitsvorschriften. Die einfache Lösung, Mitarbeiter nur innerhalb der USA zu beschäftigen, erspart Unternehmen viel Aufwand und minimiert das Risiko rechtlicher Verstöße. Das Thema Steuerrecht ist ebenso ein entscheidender Faktor.
Die steuerlichen Verpflichtungen für Unternehmen steigen erheblich, sobald sie Mitarbeiter in verschiedenen Ländern beschäftigen. Es müssen mehrere nationale Systeme berücksichtigt werden – von der Lohnsteuer und Sozialabgaben bis hin zu Meldepflichten bei ausländischen Steuerbehörden. Gerade für kleinere und mittelgroße Unternehmen, die nicht über umfassende internationale Rechts- oder Steuerabteilungen verfügen, ist dies eine große Hürde. Die Verwaltungskosten und der bürokratische Aufwand werden als zu hoch eingeschätzt, was den Fokus auf US-basierte Arbeitskräfte verstärkt. Darüber hinaus spielen politische und regulatorische Änderungen eine große Rolle.
Beispielsweise hat sich der US-Gesetzgeber in den letzten Jahren durch verschärfte Compliance-Anforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit nationaler Sicherheit und Technologieentwicklung, positioniert. Insbesondere in Unternehmen, die in Branchen mit sensiblen Daten oder kritischen Technologien tätig sind, gelten höhere Anforderungen bezüglich der Mitarbeiterstruktur. Wenn die Belegschaft hauptsächlich aus Nicht-US-Bürgern besteht, kann dies zu einer Überprüfung durch Behörden wie das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) führen. Diese Prüfungen zielen darauf ab, potenzielle Risiken für die nationale Sicherheit zu minimieren und können Unternehmen vor Herausforderungen stellen, die sie lieber umgehen wollen. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, sind die Auswirkungen der steuerlichen Vorschriften rund um Forschungs- und Entwicklungsausgaben.
Seit der Einführung der Steuerreform, insbesondere der Section 174, müssen Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen für nicht-US-Mitarbeiter länger abgeschrieben werden als für US-Beschäftigte. Während US-Mitarbeiterkosten über fünf Jahre abgeschrieben werden können, beträgt die Frist für nicht-US-bezogene Aufwendungen aktuell bis zu 15 Jahre. Diese steuerliche Ungleichbehandlung wirkt für Unternehmen demotivierend, externes oder internationales Talent einzustellen, selbst wenn die Gesamtkosten niedriger erscheinen mögen. Zeitverschiebungen und kulturelle Aspekte kommen ebenfalls als Herausforderung hinzu. Internationale Teams zu koordinieren bedeutet einen erhöhten Aufwand an Kommunikation, Meeting-Planung und teilweise auch an Arbeitszeiten der Mitarbeiter.
Firmen, die auf effiziente Prozesse angewiesen sind, sehen sich dadurch oft eingeschränkt. Zudem kann die Arbeit in unterschiedlichen gesetzlichen und kulturellen Kontexten zu Unsicherheiten bei der Mitarbeiterführung und im operativen Alltag führen. Die Konzentration auf einheitliche, einheimische Teams verringert diese Komplexität und sorgt für eine bessere Kontrolle und Integration. Parallel gehen viele US-Unternehmen dazu über, internationale Arbeitsbeziehungen nicht durch direkte Anstellung, sondern über Outsourcing- oder B2B-Modelle zu organisieren. Dabei werden Dienstleister oder Agenturen außerhalb der USA beauftragt, während die tatsächliche Beschäftigung rechtlich in den jeweiligen Ländern stattfindet.
Dieser Ansatz wird von Unternehmen als praktikable Lösung angesehen, um global verfügbare Talente zu nutzen und gleichzeitig administrative und rechtliche Risiken zu minimieren. Dennoch bleibt festzuhalten, dass hierfür oft mehr Aufwand bei der Vertragsgestaltung und Compliance betrieben werden muss. Die Corona-Pandemie hat die Verbreitung von Homeoffice und Remote-Arbeit stark beschleunigt. Dennoch hat sie auch die Grenzen der internationalen Remote-Beschäftigung aufgezeigt. Einige Unternehmen erkannten, dass die rechtlichen, steuerlichen und organisatorischen Herausforderungen oft größer sind als die Vorteile der internationalen Personalbeschaffung.
Gerade bei kleineren Teams oder Startups sind die verfügbaren Ressourcen begrenzt, weshalb eine Einstellung außerhalb der USA derzeit als zu aufwändig gilt. Interessanterweise sehen Länder wie Deutschland oder auch EU-Mitgliedsstaaten teilweise noch andere Ansätze. Dort wird Remote-Arbeit häufig nach regionalen Zeitfenstern und synchronen Arbeitszeiten organisiert, ohne zwingend auf ein restriktives „nur im Land“-Mitarbeiterprinzip zu setzen. Das europäische Rechtssystem ist jedoch ebenfalls komplex, und auch dort entscheiden sich viele Unternehmen aus ähnlichen Gründen für eine stärker lokal orientierte Personalpolitik. Für Arbeitssuchende außerhalb der USA bedeutet der Trend „US-only“ Remote vor allem eines: Es wird schwieriger, direkt bei US-Firmen als Mitarbeiter einzusteigen, vor allem wenn das Unternehmen direkt an eine Anstellung gebunden ist.
Allerdings bestehen alternative Möglichkeiten wie Freelancing, Agenturbeauftragung oder die Gründung einer kleinen internen Firma, um im B2B-Verhältnis mit US-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Auch wenn diese Wege mit mehr administrativem Aufwand verbunden sind, ermöglichen sie dennoch einen Zugang zu US-Märkten und Projekten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wandel hin zu „US-only“ Remote-Positionen das Ergebnis einer Kombination rechtlicher, steuerlicher und betrieblicher Faktoren ist. US-Unternehmen begegnen Herausforderungen, die von der Einhaltung komplexer Vorschriften über Steueroptimierung bis zu „nationalen Sicherheitsbedenken“ reichen. Gleichzeitig erfordert die effektive Steuerung von Remote-Teams neue Kompetenzen und größer angelegte organisatorische Anpassungen, auf die viele Firmen aktuell noch nicht vorbereitet sind oder diese als zu riskant und kostenintensiv ansehen.
Für Kandidaten bedeutet das eine Neuausrichtung in der Jobsuche und die Berücksichtigung alternativer Arbeitsmodelle. Die globale Arbeitswelt steht trotz zahlreicher Fortschritte weiterhin vor Hürden, wenn es um grenzüberschreitende Beschäftigung geht. Es bleibt abzuwarten, wie sich rechtliche Rahmenbedingungen und politische Regularien zukünftig entwickeln und ob sich neue Lösungen etablieren werden, die Remote-Arbeit wirklich grenzenlos machen. Bis dahin wird der Trend zu „US-only“ Remote-Arbeit voraussichtlich bestehen bleiben und prägt den Arbeitsmarkt sowohl in den USA als auch international nachhaltig.





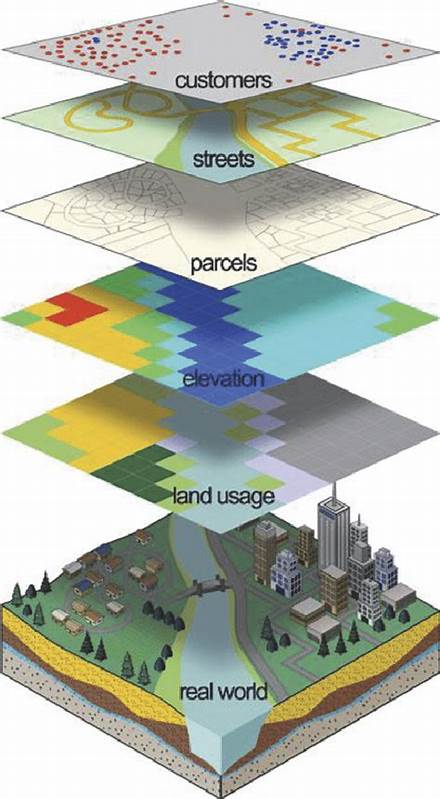


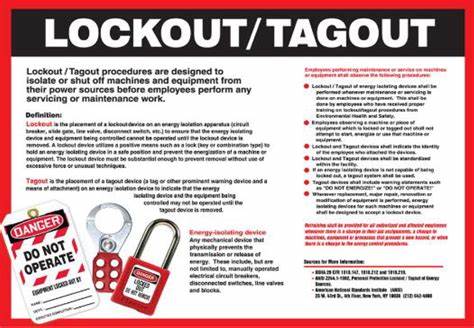
![Pioneers: Andy Hertzfeld (2019) [video]](/images/2E24041F-301A-457F-9356-D547F7B110DE)