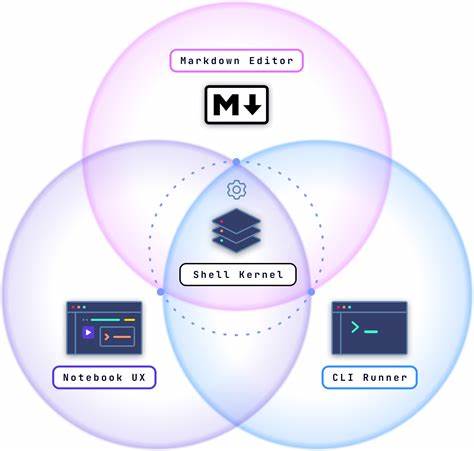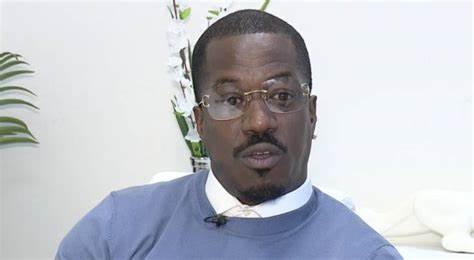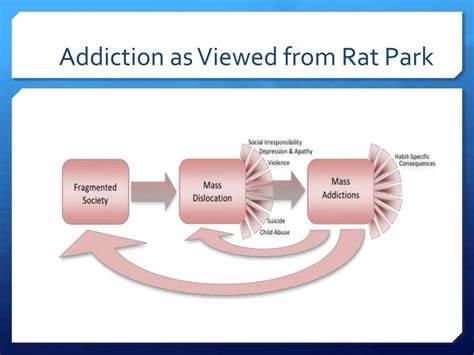Die rasante Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere von Large Language Models (LLMs), hält zunehmend Einzug in verschiedene Berufsbereiche, darunter auch das Fachgebiet des internationalen Rechts. Die Fähigkeit dieser Modelle, komplexe Texte zu verstehen und eigenständig zu kreieren, eröffnet neue Perspektiven für die Juristerei auf globaler Ebene. In den letzten Jahren haben Forschende zunehmend untersucht, ob und wie diese Technologien in internationalrechtlichen Kontexten praktisch eingesetzt werden können. Ein besonders aufschlussreiches Fallbeispiel liefert die Teilnahme von KI-generierten Schriftsätzen an der Jessup International Law Moot Court Competition, einem renommierten internationalen Wettbewerb für angehende Völkerrechtler. Die Analyse dieses Experiments zeigt einerseits das enorme Potenzial der KI in der juristischen Argumentation, verdeutlicht aber andererseits auch die bestehenden Limitationen und Herausforderungen, die mit ihrer Anwendung verbunden sind.
Die Jessup Moot Court Competition gilt als einer der prestigeträchtigsten Simulationswettbewerbe im Bereich des Völkerrechts. Rechtsstudenten aus aller Welt treten hier mit schriftlichen Stellungnahmen und mündlichen Verhandlungen an, um komplexe völkerrechtliche Streitfälle zu lösen. In der Studie von Damien Charlotin und Niccolò Ridi wurden die Modelle Gemini 2.0 und GPT4o genutzt, um Schriftsätze zu verfassen, die anschließend völlig anonym in den Wettbewerb eingespeist wurden. Die Gerichte bewerteten die Einreichungen ohne Kenntnis der KI-Herkunft, was eine objektive Bewertung der Qualität und Überzeugungskraft der KI-Argumentation ermöglichte.
Das Ergebnis überraschte viele Beobachter: Die meisten der KI-generierten Schriftsätze erreichten mindestens durchschnittliche Bewertungen, einige konnten sogar eine hervorragende Leistungsbeurteilung erzielen. Dies lässt darauf schließen, dass generative KI-Modelle in der Lage sind, juristische Texte mit beachtlicher Kohärenz und Sachkenntnis zu verfassen, die den Anforderungen eines anspruchsvollen internationalen Wettbewerbs gerecht werden. Gleichzeitig offenbarten die Rückmeldungen der Juroren jedoch auch erhebliche Schwächen der KI-gestützten Ansätze. Am auffälligsten waren häufige faktische Fehler in den Schriftsätzen, darunter unzutreffende Angaben zu relevanten Rechtsnormen oder Sachverhalten. Ein weiteres wiederkehrendes Problem war das sogenannte Halluzinieren von Zitaten, das heißt, die KI erzeugte Verweise auf Rechtsquellen oder Gerichtsurteile, die in Wirklichkeit nicht existieren.
Diese Schwächen unterstreichen die Notwendigkeit, KI-generierte Texte sorgfältig zu überprüfen, um Fehlinterpretationen oder juristische Ungenauigkeiten zu vermeiden. Darüber hinaus kritisierten Juroren die teilweise oberflächliche Tiefe der juristischen Argumentation. Während die KI komplexe rechtliche Zusammenhänge nachvollziehen und angemessen darstellen konnte, fehlte es oft an einer tiefgehenden Analyse oder kritischen Hinterfragung der Rechtslage. Dieses Defizit verweist darauf, dass menschliche Expertise auch künftig unverzichtbar bleibt, insbesondere für die Entwicklung überzeugender, differenzierter Rechtsstrategien. Neben der Bewertung der KI-Produkte selbst liefert die Studie auch wichtige Erkenntnisse für den Umgang mit KI-Technologie in der juristischen Praxis und Bildung.
So betonen die Autoren die Bedeutung von „Prompt Engineering“, also der präzisen Formulierung von Eingabeaufforderungen an die KI, um die Qualität und Relevanz der generierten Texte zu maximieren. Eine enge Kooperation zwischen menschlichen Juristen und KI-Systemen wird als besonders erfolgversprechend angesehen. Dabei nutzt der Mensch die Stärken der KI bei der schnellen Verarbeitung großer Datenmengen und der Mustererkennung, während er eigene juristische Erfahrung einbringt, um inhaltliche Genauigkeit und Tiefe sicherzustellen. Die Integration von KI-Assistenz in die juristische Arbeitsweise könnte den Zugang zu komplexen Rechtsinformationen erleichtern und die Effizienz der Fallbearbeitung steigern. Auf der anderen Seite wirft der Einsatz generativer KI im Rechtswesen auch regulatorische und ethische Fragen auf.
Insbesondere bei Tätigkeiten mit hohem Verantwortungspotenzial, wie der Rechtsberatung oder der Anfertigung gerichtlicher Schriftsätze, stellt sich die Frage nach der Haftung für Fehler, die durch KI entstehen. Zudem muss die Transparenz gewährleistet sein, um Vertrauen in den Einsatz der Technologie sicherzustellen. Legal Tech Unternehmen, Anwaltskanzleien und Bildungseinrichtungen sind daher gefordert, Richtlinien und Standards zu entwickeln, die einerseits den verantwortungsbewussten Umgang mit KI fördern, andererseits Innovationen nicht bremsen. Nicht zuletzt eröffnet der Einsatz von generativer KI neue Chancen für die juristische Ausbildung. Studierende können durch interaktive KI-Tools intensiver mit komplexen Rechtsfällen üben, schnelle Rückmeldungen erhalten und vielfältige Argumentationsstile kennenlernen.
Gleichzeitig bietet die KI Unterstützung bei umfassender Recherche und beim Verfassen juristischer Texte, was die Lernkurve erheblich verkürzen kann. Wichtig ist jedoch eine kritische Begleitung und die Förderung von Reflexionsfähigkeit, um eine einseitige Abhängigkeit von KI-Ergebnissen zu vermeiden. Insgesamt zeigt die Analyse der Anwendung von generativer KI im internationalen Recht ein vielversprechendes Bild – die Technologie hat das Potenzial, das juristische Arbeiten effizienter, gründlicher und innovativer zu gestalten. Dennoch bleibt der menschliche Faktor unverzichtbar, um Qualität, Verantwortung und ethische Standards zu gewährleisten. Die Zukunft gehört einer symbiotischen Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, bei der jede Seite ihre Stärken einbringt.
Experten gehen davon aus, dass der transformative Einfluss von KI auf das Rechtswesen in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Dabei wird es entscheidend sein, offene Diskussionen über Chancen und Risiken zu führen und den rechtlichen Rahmen kontinuierlich anzupassen, um eine sinnvolle und verantwortungsvolle Nutzung zu gewährleisten. Somit steht die juristische Gemeinschaft am Beginn einer spannenden Ära, in der Technologie und Recht Hand in Hand gehen, um komplexe globale Herausforderungen effektiver zu meistern. Die Teilnahme von KI-generierten Beiträgen am Jessup Moot Court zeigt exemplarisch, dass die Grenzen dessen, was mit maschineller Intelligenz im Rechtsbereich möglich ist, weiter verschoben werden. Gleichzeitig mahnt sie zur Vorsicht und zur gezielten Steuerung der Entwicklung.
Die Balance zwischen Innovation und Integrität wird dabei eine zentrale Rolle spielen. Nur so kann generative KI zu einem wertvollen Partner für internationale Juristen werden und die Rechtswissenschaft nachhaltig bereichern.