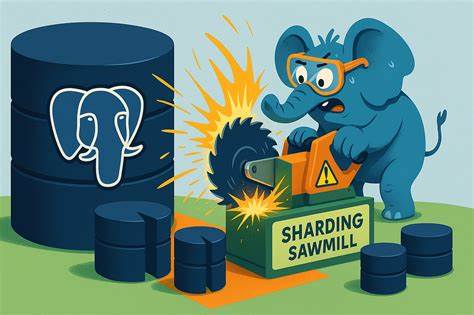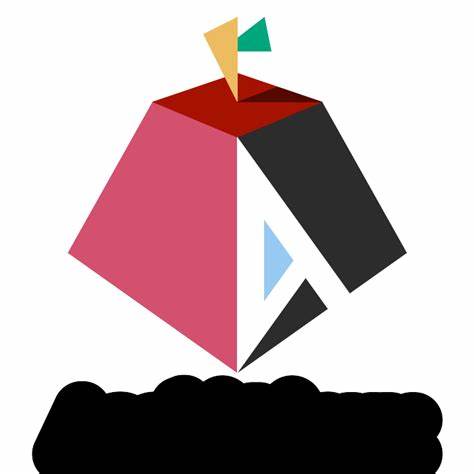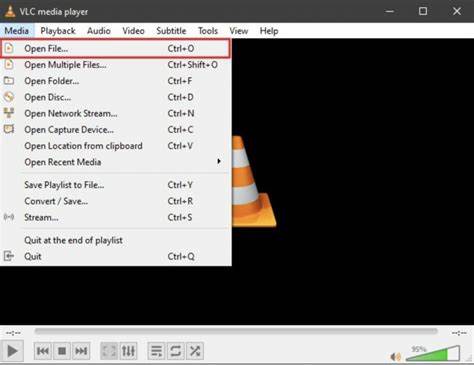In der Welt der Datenbanksysteme werden Begriffe wie Sharding und Verteilung oft synonym verwendet, dabei steckt hinter jedem Konzept eine eigene technische Wirklichkeit, die das Wesen und die Leistungsfähigkeit einer Datenbank entscheidend prägt. Besonders im Kontext von PostgreSQL, einer der beliebtesten relationalen Datenbanken weltweit, ist es wichtig zu verstehen, wo die Grenzen der Skalierbarkeit liegen und ab wann der Wechsel zu einem echten verteilten Datenbanksystem notwendig wird. PostgreSQL bietet von Haus aus exzellente Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit – jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt. Bei steigender Last und dem Bedarf an Hochverfügbarkeit und horizontaler Skalierbarkeit stoßen traditionelle Implementierungen oft an ihre Grenzen. Sharding, also das Zerlegen der Daten in mehrere kleinere Einheiten, scheint zunächst eine vielversprechende Lösung, um genau diese Limits zu überwinden.
Doch Sharding allein macht ein System noch nicht zu einem vollständig verteilten Datenbanksystem. Das Grundprinzip vieler PostgreSQL-Sharding-Lösungen wie Citus basiert darauf, dass Daten auf mehrere Server verteilt werden. Jeder Server übernimmt dabei nur einen Teil des Datenbestands, zuständig für einen bestimmten Schlüsselbereich. Damit entsteht eine Art Koordinationsebene, die eingehende Anfragen an die korrekten Knoten weiterleitet. Das klingt zunächst praktikabel und wird von vielen als gangbarer Weg gesehen, um PostgreSQL in Szenarien mit massivem Datenwachstum und hohen Anforderungen einzusetzen.
Doch es gibt entscheidende Unterschiede, die häufig übersehen werden und die Haltung gegenüber der eigenen Architektur verändern sollten. Ein großer Stolperstein bei solchen Sharding-Ansätzen ist die mangelnde Zusammenarbeit der einzelnen Datenbankinstanzen. Die einzelnen PostgreSQL-Knoten kennen sich nicht und kommunizieren nicht direkt miteinander. Das verhindert eine echte Verteilung im Sinne eines globalen Datenbankmanagements, bei dem Transaktionen über mehrere Knoten hinweg mit vollständigen ACID-Garantien verarbeitet werden. Insbesondere das Isolationselement dieser Garantien wird dadurch schwer beeinträchtigt.
Die Isolation sorgt dafür, dass parallele Transaktionen sich nicht gegenseitig beeinflussen und ein konsistenter Zustand der Datenbank zu jedem Zeitpunkt gewährleistet wird. In verteilten Systemen kommt häufig das sogenannte Zwei-Phasen-Commit-Protokoll (2PC) zum Einsatz, um atomare Commit-Operationen über mehrere Knoten zu koordinieren. Dabei wird sichergestellt, dass entweder alle beteiligten Knoten eine Transaktion vollständig durchführen oder keiner von ihnen. Allerdings bietet dieses Protokoll keine Garantie dafür, dass die Veränderungen für alle Knoten gleichzeitig sichtbar werden. Genau hierin liegt der Kern des Problems bei sharded PostgreSQL-Setups: während die Atomizität gewährleistet ist, fehlt es an einer globalen Sicht auf den Datenbestand, wodurch einzelne Knoten unterschiedliche Datenstände anzeigen können.
Ein beispielhafter Anwendungsfall verdeutlicht das Dilemma: Alice hat zwei Bankkonten, die auf zwei verschiedenen Shards gespeichert sind. Sie überweist 50 Euro von Konto X zu Konto Y – die Transaktion wird mittels 2PC orchestriert. Während diese Transaktion intern abläuft, überprüft ihr Mann Bob den Kontostand. Potenziell kann Bob einen Zwischenschritt sehen, in dem Konto X bereits den niedrigeren Betrag anzeigt, Konto Y aber noch nicht den erhöhten Saldo. Das Ergebnis ist eine inkonsistente Sicht, die zwar im Endeffekt korrekt ausfällt (nach Abschluss aller Commits), während der Transaktion jedoch irritierende Zwischenergebnisse liefert.
Dieses Verhalten wird als eventual consistency bezeichnet – die Datenkorrektheit stellt sich irgendwann ein, kann aber vorübergehend abweichen. Für viele Anwendungsfälle mag das akzeptabel sein, für kritische Systeme wie Banken oder medizinische Anwendungen jedoch nicht. Hier sind transaktionale Integrität und Konsistenz unverzichtbar. Citus, als populäre PostgreSQL-Sharding-Erweiterung, illustriert dieses Spannungsfeld sehr gut. Obwohl Citus Multi-Shard-Transaktionen unterstützt und damit auf den ersten Blick ACID-Garantien gewährleistet, ist die Isolationsebene dieser Transaktionen effektiv auf „Read Committed“ beschränkt.
Die fehlende Unterstützung für vollständige verteilte Snapshot-Isolation führt dazu, dass gleichzeitige Multi-Knoten-Transaktionen nicht das strenge Konsistenzniveau erreichen, das man von einem traditionellen monolithischen Datenbanksystem erwarten würde. Die offiziellen Dokumentationen von Citus und einschlägige Fachliteratur weisen darauf hin, dass Distributed Snapshot Isolation erhebliche Performanceeinbußen mit sich bringen würde. Die zusätzlichen Netzwerkrunden und das Warten auf globale Zeitstempel oder Koordination verteuern Transaktionen und mindern die Skalierbarkeit spürbar. Die Entwickler von Citus sind sich dessen bewusst und haben sich daher für eine Kompromisslösung entschieden, die die Performance auf Kosten einiger Konsistenzgarantien maximiert. Diese Kompromisse spiegeln eine zentrale Diskussion wider, die in Datenbankforschung und Praxis seit Jahren geführt wird.
Die Frage lautet: Soll man für maximale Durchsatzleistung und möglichst geringe Latenzen auf strenge Transaktionsgarantien verzichten oder ist eine kompromisslose Konsistenz unerlässlich – und in diesem Fall akzeptiert man eine höhere Latenz und komplexere Architektur? Die Antwort hängt stark vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Finanzinstitute beispielsweise werden kaum auf kompromisslose ACID-Garantien verzichten, während manche Webanwendungen mit eventual consistency gut zurechtkommen. Ein entscheidender Nachteil sharded PostgreSQL-Lösungen ist darüber hinaus die erhöhte Komplexität für Entwickler. Anwendungen müssen mit potenziellen Inkonsistenzen umgehen und zusätzliche Logik implementieren, um diese zu erkennen und zu managen. Dieses Szenario erhöht die Gefahr von Bugs und bringt zusätzlichen Entwicklungsaufwand mit sich.
Im Gegensatz dazu bieten moderne verteilte SQL-Datenbanken wie YDB umfassende Unterstützung für ACID-Transaktionen auch über mehrere Knoten hinweg. Sie garantieren strenge Konsistenz und Isolation, setzen dabei aber auf speziell optimierte, verteilte Protokolle, die zwar zusätzliche Latenzen mit sich bringen, aber gleichzeitig Skalierbarkeit und Verfügbarkeit sicherstellen. Benchmark-Analysen zeigen, dass diese verteilten Systeme mittlerweile in puncto Performance enger an monolithische Lösungen wie PostgreSQL heranrücken, während sie deren Einschränkungen überwinden. Betrachtet man die Kosten verteilter Transaktionen, spielt die Netzwerklatenz eine zentrale Rolle. Während lokale PostgreSQL-Transaktionen ohne verschiedene Replikationsmechanismen oft sehr schnell sind, ergeben sich durch synchron replizierte Umgebungen oder die Two-Phase Commit-Protokolle zusätzliche Zeitaufwände, die sich durch mehrere Round-Trip Times (RTT) definieren lassen.
Für verteilte Datenbanken mit komplett konsistenten Transaktionen summieren sich diese RTTs oft weiter, was die Gesamttransaktionszeit erhöht. Interessanterweise zeigen Studien, dass bei Latenzen unter 7 Millisekunden die Differenz zwischen sharded und voll verteilten Systemen nur im niedrigen zweistelligen Millisekundenbereich liegt. Für viele praktische Anwendungen erscheint dieser Preis für die fairnessicheren Konsistenzgarantien jedoch durchaus gerechtfertigt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass PostgreSQL innerhalb seiner Domäne ein herausragendes System ist, das für viele Anwendungsfälle optimal passt. Sobald jedoch Anforderungen wie horizontale Skalierung über mehrere Server hinweg, globale Konsistenz und strikte ACID-Garantien greifen, bietet Sharding nur eine teilweise Antwort.
Die fehlende Kommunikation und Koordination zwischen den Shards macht vollwertige verteilte Transaktionen unmöglich, wodurch Entwickler Kompromisse eingehen müssen, die zu komplexeren Anwendungen und potenziellen Inkonsistenzen führen. Für Unternehmen und Projekte, die auf absolute Datenintegrität und nahtlose Skalierbarkeit angewiesen sind, sollten deshalb moderne verteilte Datenbanken mit integrierten ACID-Transaktionen den Vorzug erhalten. Diese Systeme verbinden die Vorteile der Skalierung mit einer starken Konsistenz, womit sie für zukunftsfähige Architekturen bestens gerüstet sind. Dabei sollte die Entscheidung stets wohlüberlegt getroffen werden und technische Möglichkeiten, Anwendungsanforderungen und Performanceerwartungen eingehend abgewogen werden. Die zentrale Erkenntnis lautet: Sharded ist nicht gleich distributed.
Die subtile Differenz zwischen diesen Begriffen ist essenziell, um ein Datenbanksystem zu wählen, das den Anforderungen des jeweiligen Umfelds gerecht wird – besonders, wenn PostgreSQL an seine Grenzen stößt.