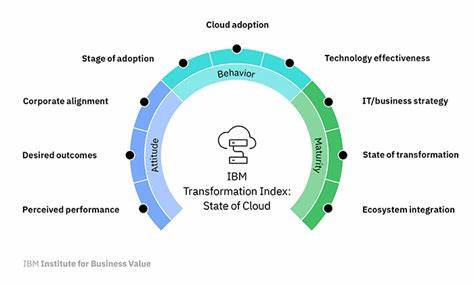Meta plant ab dem 27. Mai 2025, personenbezogene Daten von Instagram- und Facebook-Nutzern in Europa für das Training seiner neuen KI-Systeme zu verwenden. Anstatt die Nutzer um eine explizite Einwilligung zu bitten, beruft sich der Konzern auf ein angebliches "berechtigtes Interesse", um die Daten ohne vorherige Zustimmung zu verarbeiten. Dies hat bei Datenschutzaktivisten und Verbraucherschützern in der Europäischen Union großen Widerstand ausgelöst. Die Datenschutzorganisation Noyb hat in ihrer Funktion als sogenannte "Qualified Entity" im Rahmen der neuen EU-Kollektivklagerechtsrichtlinie einen förmlichen Forderungsbrief, bekannt als Unterlassungserklärung, an Meta Irland geschickt und droht mit weiteren rechtlichen Schritten, darunter einer europaweiten Sammelklage.
Die rechtlichen Risiken für Meta könnten erheblich sein und sich in Milliardenhöhe schadensersatzpflichtig manifestieren – allein aufgrund der Entscheidung, auf ein Opt-Out-System statt ein Opt-In-System zu setzen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten in der EU unterliegt den strengen Regeln der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Demnach dürfen personenbezogene Daten nur auf einer von sechs rechtlichen Grundlagen gemäß Artikel 6 Absatz 1 DSGVO verarbeitet werden. Die am häufigsten verwendete ist die Einwilligung, also eine freiwillige, informierte und unmissverständliche Zustimmung der Nutzer. Im Gegensatz dazu besteht die Möglichkeit, Daten aufgrund eines sogenannten "berechtigten Interesses" zu verarbeiten.
Doch diese Grundlage ist restriktiv und erfordert eine sorgfältige Abwägung der Interessen des Unternehmens gegenüber den Rechten der Betroffenen. Meta argumentiert, dass das Unternehmen ein berechtigtes Interesse daran habe, die großen Mengen an Nutzerdaten für das Training seiner KI-Modelle heranzuziehen. Dem widersprechen allerdings Datenschützer wie Max Schrems vehement. Er verweist auf frühere Urteile des Europäischen Gerichtshofs, der entschieden hat, dass Meta kein berechtigtes Interesse im Bereich der personalisierten Werbung geltend machen kann. Wie soll das Unternehmen dann ein solches Interesse für das umfassende Sammeln von Nutzerdaten für die KI-Entwicklung haben? Diese Haltung stelle einen eklatanten Missbrauch der Rechtsgrundlage dar und setze die kommerziellen Interessen über die Grundrechte der Nutzer.
Ein zentrales Problem aus Sicht von Noyb ist zudem die Art des Umgangs mit dem Widerspruchsrecht. Laut DSGVO haben Betroffene das Recht, der Verarbeitung ihrer Daten zu widersprechen (Opt-Out). Meta beschränkt dieses Recht aber weiter und verwehrt es den Nutzern, wenn sie nicht vor dem Start des KI-Trainings aktiv widersprechen. Dadurch sind viele Nutzer faktisch gezwungen, ihre Daten ungefragt preiszugeben. Ein weiteres Datenschutzproblem ergibt sich daraus, dass Meta das trainierte KI-Modell Llama als Open Source Software bereitstellt.
Sobald das Modell veröffentlicht ist, kann das Unternehmen kaum noch Eingriffe vornehmen, etwa Daten korrigieren oder löschen – grundlegende Rechte der Betroffenen werden somit faktisch ausgehebelt. Dies sorgt für zusätzliche juristische Unsicherheiten und gefährdet die Einhaltung der DSGVO-Grundrechte. Der Vorschlag von Noyb ist simpel und praktikabel: Meta sollte die Nutzer im Vorfeld klar und transparent um eine freiwillige Zustimmung zum Einsatz ihrer Daten bitten. Ein Opt-In-Verfahren würde sicherstellen, dass die Einwilligung „freiwillig, spezifisch, informiert und unmissverständlich“ erfolgt – genau so, wie es die DSGVO verlangt. Bereits ein kleiner Prozentsatz an freiwilligen Teilnehmern würde genügen, um die KI-Modelle für die europäische Region sprachlich und kulturell anzupassen.
Diese Forderung zeigt auch, dass das Konzept von Meta, alle verfügbaren Nutzerdaten der vergangenen Jahre für die KI auszuwerten, weder notwendig noch verhältnismäßig ist. Andere führende Anbieter im Bereich Künstliche Intelligenz, wie beispielsweise OpenAI oder das französische Start-up Mistral, kommen ohne Zugang zu Social-Media-Daten zurecht und erzielen dennoch bemerkenswerte Ergebnisse. Daher ist es aus datenschutzrechtlicher Sicht schwer nachvollziehbar, warum Meta eine solch umfassende Datennutzung ohne explizite Einwilligung durchsetzen möchte. Die neue EU-Kollektivklagerechts-Richtlinie ermöglicht qualifizierten Organisationen wie Noyb, EU-weit Unterlassungsverfügungen einzuklagen. Mit einer gerichtlichen Verfügung könnte Meta gezwungen werden, die Datenverarbeitung sofort einzustellen und sämtliche mit europäischen Daten trainierten KI-Modelle zu löschen.
Selbst Modelle, die vermischt mit nicht-europäischen Daten trainiert wurden, müssten dann verworfen werden. Zudem würde eine solche Verfügung die Frist zur Geltendmachung etwaiger Schadenersatzansprüche für betroffene Nutzer stoppen. Angesichts der enormen Nutzerzahl von etwa 400 Millionen Menschen in Europa würde eine Schadensersatzsumme von nur 500 Euro pro Nutzer theoretisch in einem hohen zweistelligen Milliardenbereich liegen. Neben dem Vorstoß von Noyb zeigt sich auch bei anderen Verbraucherschutzorganisationen wie der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZ NRW) ein entschlossener Widerstand gegen das Vorgehen von Meta. Die VZ NRW hat bereits einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung eingereicht, um die KI-Datenverarbeitung in Deutschland zu stoppen und den Schutz der Nutzerrechte durchzusetzen.
Die gebündelte Rechtskraft solcher Klagen könnte den Druck auf Meta weiter erhöhen. Das Verhalten von Meta wird zudem kritisch beleuchtet, weil die geplante Verarbeitung ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzer voranschreitet, obwohl Meta behauptet, eng mit EU-Datenschutzaufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten. In Wirklichkeit scheinen viele dieser Behörden eine abwartende Haltung einzunehmen und raten lediglich den Nutzern, sich selbst durch Widerspruchsschutz zu wehren. Diese Taktik verschiebt die Verantwortung auf die Anwender, obwohl die DSGVO klar begünstigt, Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Max Schrems und Noyb beobachten mit Sorge, dass viele Datenschutzbehörden durch politisch bedingte Prioritäten Innovation über Rechtsstaatlichkeit stellen und somit die Schutzmechanismen der DSGVO unterminieren.
In diesem besonderen Fall der KI-Datenverarbeitung stehe vor allem das Grundprinzip der Freiwilligkeit und Transparenz auf dem Prüfstand. Der Ausgang dieses Rechtsstreits wird weitreichende Folgen für den Umgang mit personenbezogenen Daten für KI-Anwendungen in Europa haben. Sollte Meta gezwungen sein, sein Geschäftsmodell anzupassen und künftig auf ein Opt-In-System zu wechseln, könnte dies einen Präzedenzfall schaffen, der andere Unternehmen und Sektoren betrifft. Gleichzeitig würde dies eine klare Botschaft senden, dass auch Tech-Giganten an die europäischen Datenschutzstandards gebunden sind und keine Sonderrechte beanspruchen können. Die öffentliche Aufmerksamkeit und die rechtlichen Schritte von Noyb stärken zudem die Debatte über den ethischen und verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz.