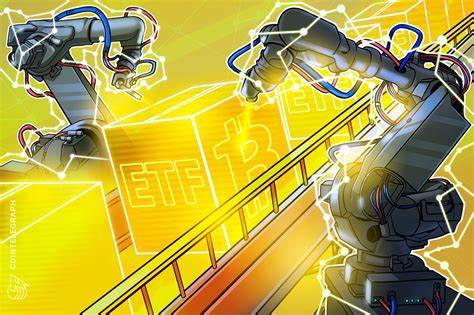Flüsse und Bäche gelten seit langem als wichtige Akteure im globalen Kohlenstoffkreislauf, da sie aktiv Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4) in die Atmosphäre abgeben. Bis vor Kurzem nahm man jedoch an, dass die Emissionen vorwiegend aus jüngeren, also subdekadischen, biologischen Quellen stammen und somit schlicht Teil des kurzfristigen Ökosystemstoffwechsels sind. Diese Annahme ist nun durch eine bahnbrechende Studie in Frage gestellt worden, die belegt, dass über die Hälfte des CO2, das von Flüssen emittiert wird, auf uralte, prähistorische Kohlenstoffvorräte zurückgeht. Dieses uralte CO2 wird aus Boden- und Sedimentschichten freigesetzt, die zum Teil Jahrtausende alt sind und bislang als stabil und klimatisch irrelevant galten. Die Forschenden haben neue und bestehende Messdaten radiokarbonhaltiger gelöster anorganischer Kohlenstoffverbindungen (DIC), CO2 und CH4 zusammengeführt, um eine globale Datenbasis zu schaffen.
Die Analyse dieser Isotopendaten zeigt, dass rund 59 Prozent der CO2-Emissionen aus Flüssen aus Kohlenstoffquellen stammen, die millenniaalt oder sogar noch älter sind. Etwa 52 Prozent entfallen auf organischen Kohlenstoff dieser langen Zeitspanne, weitere sieben Prozent auf sogenannten petrogenen Kohlenstoff, also auf abgebautes organisches Material aus Gesteinen. Diese Erkenntnis ist ein entscheidender Durchbruch, da sie eine bedeutende und zuvor nicht berücksichtigte Dimension im Kohlenstoffkreislauf offenbart. Die Freisetzung dieser alten Kohlenstoffbestände geschieht durch hydrologische Prozesse, vor allem durch laterale Wasserbewegungen, die organische Substanz und gelösten Kohlenstoff aus Böden und Sedimentschichten mobilisieren und in Flusssysteme einspeisen. Von dort gelangt dieser Kohlenstoff in gelöster Form oder als Gas in die Atmosphäre.
Dieses Phänomen erhöht den natürlichen Fluss von Kohlenstoff erheblich und zeigt, dass die Landoberfläche eine deutlich größere Rolle bei CO2-Emissionen spielt, als bisher angenommen. Die Folgen dieser Entdeckung für das Verständnis des globalen Klimasystems sind immens. Bislang gingen die meisten Klimamodelle davon aus, dass Flüsse CO2 ausschließlich aus dem kurzfristigen biologischen Stoffwechsel abgeben, das heißt aus Kohlenstoff, der maximal wenige Jahrzehnte alt ist. Die Erkenntnis, dass ein Großteil des Fluss-CO2 aus alten, vorindustriellen Kohlenstoffvorräten stammt, stellt diese Annahme infrage und legt nahe, dass Modelle die Kohlenstoffflüsse nicht vollständig erfassen. Diese neuen Daten werfen ein ganz neues Licht auf sogenannte „natürliche Kohlenstofflecks“, die zuvor übersehen wurden.
Die freigesetzten altzeitlichen Kohlenstoffmengen entsprechen etwa 1,2 Petagramm Kohlenstoff pro Jahr, was ungefähr der Menge entspricht, die von terrestrischen Ökosystemen netto aufgenommen wird. Diese Größenordnung ist so bedeutend, dass sie die bisherigen globalen Kohlenstoffbilanzen durcheinanderwirbelt und eine erneute Betrachtung der terrestrischen Senken und Quellen zwingend notwendig macht. Ob diese Freisetzung von altem Kohlenstoff durch natürliche Schwankungen im Ökosystem oder durch menschliche Aktivitäten, wie Landnutzungsänderungen oder Klimawandel, verstärkt wird, ist derzeit noch offen. Wissenschaftler weisen darauf hin, dass dies eine Schlüsselwissenlücke darstellt, deren Beantwortung essenziell für die Prognose zukünftiger Klimatrends ist. Unabhängig davon unterstreicht die Studie die Komplexität des Kohlenstoffkreislaufs und die Herausforderungen bei der präzisen Modellierung dieser Prozesse.
Diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse haben direkten Einfluss auf die Debatten über den menschengemachten Klimawandel und die Politikgestaltung im Bereich der CO2-Emissionen. Viele Klimamodelle und globale CO2-Budgets basieren darauf, dass Fluss-CO2 jüngeren Ursprungs ist und somit als Teil des temporären Naturkreislaufs angesehen wird. Die Tatsache, dass alte Kohlenstoffreserven signifikant emittiert werden, bedeutet, dass die Zuweisung von CO2-Quellen zu menschlichen oder natürlichen Ursprüngen schwieriger ist als vorher angenommen und dass natürliche Quellen wesentlich aktiver sind. Die Studie ruft auch dazu auf, politische Maßnahmen und internationale Klimastandards zu überdenken, um diese komplexeren Naturprozesse einzubeziehen. Das bisherige Modell, in dem Flüsse hauptsächlich als Kohlenstoffsenken oder kurzfristige Kohlenstoffexporteure gesehen werden, ist nicht ausreichend, um die tatsächlichen Emissionen zuverlässig zu erfassen.
Darüber hinaus beleuchtet die Studie die Bedeutung der Rheinierung und des methodischen Fortschritts bei der Analyse des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Mit der Kombination isotopischer Messungen und umfassender Datenanalysen können Wissenschaftler heute präzisere Einblicke in die Quellen und Prozesse der CO2-Freisetzung gewinnen, was früher nicht möglich war. Diese verbesserten Messmethoden sind der Schlüssel zur Verfeinerung unserer Klimamodelle und zum besseren Verständnis der atmosphärischen CO2-Dynamik. Neben der wissenschaftlichen Bedeutung hat die neue Erkenntnis auch Auswirkungen auf Umweltschutz, Landnutzungsstrategien und nachhaltige Ressourcennutzung. Wenn uralter Kohlenstoff durch Bodenerosion, Landnutzung oder Wasserhaushaltsveränderungen verstärkt freigesetzt wird, könnten Eingriffe zur Bodenerhaltung oder Wiederaufforstung helfen, diese Emissionen zu mindern.
Ebenso ist die Rolle der geologischen Kohlenstoffspeicher, beispielsweise durch Gesteinserosion und Verwitterung, noch weitgehend unerforscht und kann künftig eine größere Rolle spielen. Flüsse bleiben somit nicht nur Lebensadern für zahlreiche Ökosysteme, sondern auch dynamische Agenten im globalen Kohlenstoffhaushalt. Indem sie alte Kohlenstoffvorräte wieder an die Atmosphäre abgeben, tragen sie zu einem komplexen, bislang unterschätzten Teil des natürlichen CO2-Kreislaufs bei. Dieses Wissen erweitert unser Verständnis darüber, wie engverzahnt und sensibel natürliche Systeme auf Umweltveränderungen reagieren. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Entdeckung der uralten Kohlenstoffquellen als bedeutende CO2-Emittenten aus Flüssen den Blick auf den Klimawandel und den Kohlenstoffkreislauf grundlegend verändert.
Sie zeigt, dass natürliche Prozesse wesentlich komplexer sind, als es die bisherigen Modelle veranschaulichen, und fordert die Wissenschaftsgemeinde auf, ihre Konzepte und Berechnungen zu überarbeiten. Gleichzeitig bietet dieses Wissen Chancen, den Einfluss natürlicher Quellen und Senken auf das Klima besser zu verstehen und entsprechend wirksamer zu steuern. Somit steht die Forschung vor einer spannenden neuen Phase, die das Zusammenspiel von Flüssen, Böden, Atmosphäre und Klima in den Mittelpunkt rückt und den Weg für verbesserte Klimastrategien ebnet.