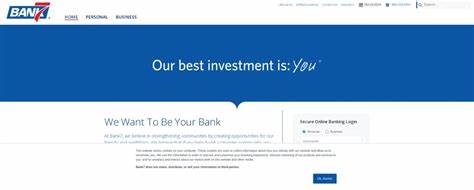Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz, insbesondere von Sprachmodellen wie ChatGPT, wirft zunehmend Fragen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltbelastung auf. Viele Menschen fragen sich, wie groß der ökologische Fußabdruck tatsächlich ist, wenn sie täglich mit ChatGPT interagieren. Sind wir durch die Verwendung solcher Technologien Klimasünder oder können wir beruhigt auf diese Innovationen zurückgreifen, ohne unserer Umwelt zu schaden? Um diese Fragen zu beantworten, bedarf es einer differenzierten Betrachtung des Energieverbrauchs, der Emissionen und des Kontextes, in dem solche Technologien eingesetzt werden. Dabei werden aktuelle Studien und Daten herangezogen, um ein realistisches Bild zu vermitteln. \n\nZunächst einmal ist es sinnvoll, den Energieverbrauch eines einzelnen ChatGPT-Dialogs in Relation zum alltäglichen Stromverbrauch einer Person zu setzen.
Laut Analyse von Fachleuten benötigt ein einzelner ChatGPT-Query ungefähr drei Wattstunden (Wh) Strom. Diese Zahl mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, insbesondere im Vergleich zu einer Google-Suche, die signifikant weniger Energie verbraucht. Trotzdem relativiert sich diese Zahl, wenn weitere Faktoren berücksichtigt werden. Der durchschnittliche jährliche Pro-Kopf-Stromverbrauch in Deutschland und vergleichbaren Ländern bewegt sich bei mehreren tausend Kilowattstunden. Im direkten Vergleich macht der Strom für einen einzigen ChatGPT-Fragevorgang also nur einen winzigen Bruchteil des täglichen Stromverbrauchs aus.
\n\nWenn man annimmt, dass jemand durchschnittlich zehn Anfragen pro Tag an ChatGPT stellt, beträgt der daraus resultierende Energieverbrauch nur einen Bruchteil eines Prozents seines Gesamtverbrauchs. Selbst bei hundert Abfragen täglich erhöht sich der Anteil auf lediglich wenige Prozent der gesamten Stromnutzung. In den USA, wo der Stromverbrauch pro Kopf höher liegt als in Europa, ist dieser Anteil noch geringer. Die tatsächliche Umweltbelastung, gemessen am CO2-Ausstoß, ist damit für den individuellen Nutzer vernachlässigbar. \n\nDie Ermittlung der CO2-Emissionen eines ChatGPT-Dialogs hängt jedoch stark davon ab, wie sauber der zugrundeliegende Strommix ist.
Wird der verwendete Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen, ist der ökologische Fußabdruck deutlich geringer als bei fossilen Energiequellen. Experten gehen momentan davon aus, dass eine Anfrage an ChatGPT zwischen zwei und drei Gramm CO2 verursacht, inklusive eines anteiligen Anteils für das Training des Modells. Bei zehn Anfragen täglich summiert sich das auf etwa elf Kilogramm CO2 jährlich, was im Verhältnis zur durchschnittlichen Pro-Kopf-Emission eines Deutschen von rund sieben Tonnen sehr gering ist. \n\nIm Vergleich zu anderen alltäglichen Aktivitäten, die wesentlich größere Mengen CO2 verursachen, fällt die Nutzung von ChatGPT also kaum ins Gewicht. So umfasst der Klimaschutz vor allem Handlungen mit großer Einsparwirkung wie die Reduktion tierischer Produkte in der Ernährung, der Verzicht auf Flugreisen oder die Umstellung auf erneuerbare Heizmethoden.
Im Kontext solcher Maßnahmen erscheint die Energieaufnahme von KI-Anwendungen wie ChatGPT sehr überschaubar. \n\nInteressanterweise gibt es mittlerweile Untersuchungen, die nahelegen, dass der Energieverbrauch pro Anfrage sogar um den Faktor zehn niedriger liegt als bisher angenommen. Gerade technologische Fortschritte in der Effizienz von Rechenzentren und Algorithmen führen zu einer besseren Energienutzung. Eine neue Schätzung weist auf nur noch 0,3 Wattstunden je ChatGPT-Query hin. Wenn diese Zahl zutrifft, reduziert sich der relative Energieverbrauch der Nutzer noch weiter und macht ChatGPT noch umweltfreundlicher.
\n\nEs ist wichtig bei all diesen Betrachtungen zu verstehen, dass die individuelle Nutzung nur einen kleinen Teil der Gesamtbelastung durch Künstliche Intelligenz ausmacht. Der größte Eins-zu-Eins Zusammenhang besteht auf Ebene der Datenzentren und der großen Modelle, die trainiert werden müssen. Hier liegen die Hauptenergieverbräuche, die in Zukunft ähnlich optimiert werden müssen wie andere technologische Bereiche, um insgesamt nachhaltiger zu werden. Zudem steht und fällt die Umweltbilanz von KI-Lösungen maßgeblich mit der Herkunft der verwendeten Energie. Rechenzentren, die auf erneuerbare Energien setzen, können den CO2-Ausstoß stark minimieren.
\n\nNeben dem reinen Stromverbrauch gibt es jedoch weitere indirekte Umweltaspekte, die gerne in der Debatte miteinbezogen werden. Künstliche Intelligenz benötigt eine umfangreiche Hardware-Infrastruktur, deren Produktion mit dem Abbau von Rohstoffen, großem Wasserverbrauch und teilweise schädlicher Abfallentsorgung verbunden ist. Diese Umstände verdeutlichen, dass Nachhaltigkeit im Bereich der Digitalisierung als Gesamtkomplex verstanden werden muss und nicht nur anhand des Stromverbrauchs einzelner Anwendungen. \n\nNicht zuletzt wirft die ungebremste Nutzung von KI auch Fragen zur gesellschaftlichen Verantwortlichkeit auf. Jeder einzelne Nutzer trägt durch seine Nutzung zu einer Nachfrage bei, die Unternehmen motiviert mehr KI-basierte Produkte und Dienstleistungen anzubieten.
Ob diese Entwicklung immer sinnvoll ist, muss immer wieder kritisch hinterfragt werden, auch aus ökologischer Perspektive. Es ist Aufgabe von Konsumenten, Entwicklern und Politik, einen bewussten Umgang mit der Technologie sicherzustellen. \n\nDennoch sollte die Sorge um den CO2-Fußabdruck bei der Nutzung von ChatGPT der Realität entsprechen und nicht zu einer übertriebenen Verunsicherung führen. Studien zeigen klar, dass die Umweltbelastungen durch einzelne Anfragen im Vergleich zu vielen gewohnten Lebensgewohnheiten marginal sind. Es ist eher wertvoll, den Mehrwert durch Effizienzgewinne im Arbeitsprozess, Bildung oder Forschung zu sehen, die durch den Einsatz von KI entstehen.
Jeder Nutzer kann bewusst entscheiden, unter welchen Umständen und wie häufig er ChatGPT nutzt, ohne dabei Angst vor einem negativen ökologischen Einfluss haben zu müssen. \n\nZusammenfassend lässt sich sagen, dass der CO2-Fußabdruck eines Nutzers von ChatGPT im Alltag gering ausfällt, auch bei moderater bis höherer Nutzung. Die Technologie selbst erfordert Energie, doch die kontinuierliche Verbesserung der Effizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und die vergleichsweise geringe Menge Strom pro Anfrage reduzieren die Umweltbelastung beträchtlich. Wer auf eine nachhaltige Digitalisierung setzt, sollte diese Aspekte berücksichtigen, gleichzeitig aber auch Qualität vor Quantität bei der Nutzung von KI in den Fokus stellen. \n\nDie Diskussion über den ökologischen Fußabdruck von KI wie ChatGPT ist nur ein Teil eines größeren Debattenfeldes um nachhaltige Technologien, Energiepolitik und gesellschaftliche Verantwortung.
Wenn diese Themen ganzheitlich betrachtet werden, können wir die Chancen Digitalisierung zu nutzen, ohne dabei die Umwelt unnötig zu belasten. Künstliche Intelligenz ist somit weder Klimakiller noch Allheilmittel, sondern ein Werkzeug, dessen ökologische Verträglichkeit von effizientem Betrieb und bewusster Anwendung abhängt.