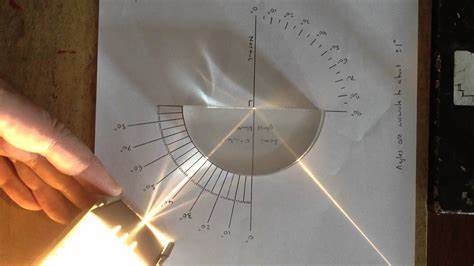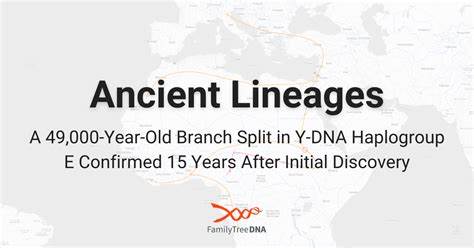Die Dringlichkeit, den Klimawandel zu bekämpfen, wird weltweit immer deutlicher. Extremtemperaturen und häufigere Wetterextreme prägen zunehmender das Bild unseres Planeten. Im Jahr 2024 lag die globale Durchschnittstemperatur bereits 1,6 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau, was das schwierige Ziel aus dem Pariser Abkommen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, in weite Ferne rückt. Angesichts dieser Entwicklungen nimmt die wissenschaftliche Gemeinschaft verstärkt alternative Ansätze ins Visier, um die globale Erwärmung zusätzlich zur Reduktion von Treibhausgasemissionen zu bekämpfen. Eine davon sind Experimente aus Großbritannien, die darauf abzielen, Sonnenlicht aktiv zu reflektieren und auf diese Weise das Klima abzukühlen.
Diese Methoden werden unter dem Begriff Solar Radiation Modification (SRM) zusammengefasst. Die britische Advanced Research and Innovation Agency (ARIA) hat jetzt ein Budget von knapp 60 Millionen Pfund für Projekte freigegeben, die diese umstrittenen Techniken erforschen und in realen Umgebungen erproben sollen. Die Bandbreite der geplanten Untersuchungen reicht von der Verdickung arktischen Meereises bis hin zur experimentellen Aufhellung von Wolken über der Küste Großbritanniens. Die Wissenschaft, die hinter SRM steht, basiert auf natürlichen Prozessen, die bereits nach starken Vulkanausbrüchen beobachtet wurden: Vulkangase und -asche reflektieren Sonnenstrahlen und führen so temporär zu einer Abkühlung der Erde. Dieses Prinzip soll nun künstlich nachgebildet werden, um so einen Effekt zu erzielen, der das Klima stabilisieren und die Erderwärmung zumindest zeitweise eindämmen könnte.
Neben der Ambition, direkt messbare Kühleffekte zu generieren, geht es auch um ein besseres Verständnis der möglichen Risiken und Nebenwirkungen. Dazu gehören etwa Veränderungen globaler Wetter- und Niederschlagsmuster oder unvorhersehbare Auswirkungen auf empfindliche Ökosysteme. Einer der vielversprechendsten Ansätze in Großbritannien ist das sogenannte Marine Cloud Brightening (MCB). Hierbei wird versucht, Meerwasser in feinen Nebel zu versprühen, der in der Atmosphäre Wolkentröpfchen verstärkt und somit die Reflektivität der Wolken erhöht. Dies könnte die Sonnenstrahlung, die die Erdoberfläche erreicht, effektiv reduzieren.
Erste Feldversuche sind ab dem Winter geplant, bei denen von Küstenstandorten aus eine feine natürliche Nebelwolke in die Atmosphäre abgegeben werden soll. Parallel dazu soll auch das dickere Meereis in der Arktis untersucht werden. Die Idee dahinter ist, dass dickeres Eis mehr Sonnenlicht reflektiert als offenes Wasser und somit zur Gedämpfung der Erderwärmung beiträgt. Den Forschern geht es dabei nicht allein um technische Machbarkeit, sondern auch um Messungen der Auswirkungen auf Flora, Fauna und lokal betroffene Bevölkerungsgruppen. Weitere Projekte befassen sich mit dem Stratospheric Aerosol Injection (SAI).
Dabei sollen mineralische Staubpartikel oder Aerosole in die Stratosphäre ausgebracht werden, um dort die Sonnenstrahlung zu reflektieren. In Großbritannien testen Wissenschaftler in einem ersten Schritt, wie Mineraldust, verpackt in einen Wetterballon, in hohen Atmosphärenschichten reagiert. Wichtig dabei: Es erfolgt keine Freisetzung des Materials in die Umwelt. Die gesamte Forschung wird von transparenten Gesprächen mit der Öffentlichkeit begleitet, um gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern und mögliche Umweltbelastungen frühzeitig zu identifizieren und zu minimieren. Trotz der wissenschaftlichen Fortschritte stehen die SRM-Methoden in der Kritik.
Experten warnen davor, dass solche Techniken eine gefährliche Illusion von Sicherheit erzeugen könnten und als Ablenkung von der eigentlichen Aufgabe dienen – nämlich der drastischen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Zudem bestehen Bedenken, dass die großflächige Anwendung von SRM unvorhersehbare und möglicherweise irreversible Veränderungen in Wetter- und Klimamustern mit sich bringen könnte. Beispielsweise könnten durch die Erhöhung der Wolkenreflexion über bestimmten Regionen Dürren in weit entfernten Gebieten ausgelöst werden – etwa in der Amazonasregion, die als „Lunge der Erde“ eine zentrale Rolle spielt. Weitere Probleme sind die noch immer fehlenden internationalen regulatorischen Rahmenbedingungen. Aktuell gibt es keine global verbindlichen Gesetze zur Geo-Engineering, was bedeutet, dass verschiedene Länder oder private Unternehmen unabhängig voneinander solche Technologien erforschen oder sogar anwenden könnten.
Eine kommerzielle Firma aus den USA entwickelt beispielsweise sogenannte „Cooling Credits“ und setzt wasserstoffgefüllte Ballons in die Stratosphäre ein, um größtenteils Schwefeldioxid freizusetzen, das als Aerosol wirkt. Diese Aktivität führte bereits zu politischen Gegenreaktionen, wie dem Versuch Mexikos, Solar Geoengineering zu verbieten. Auch in den USA haben mehrere Bundesstaaten mittlerweile Gesetze verabschiedet, die Geo-Engineering und Wettermodifikationen einschränken oder verbieten. Angesichts dieser komplexen Gemengelage aus wissenschaftlichem Fortschritt, politischen Risiken und ethischen Herausforderungen ist die Bedeutung der britischen Versuche umso größer. Die Experimente dienen als wichtige Brücken zur Erkenntnisgewinnung in einem Bereich, der global potenziell bahnbrechend, aber auch hochriskant ist.