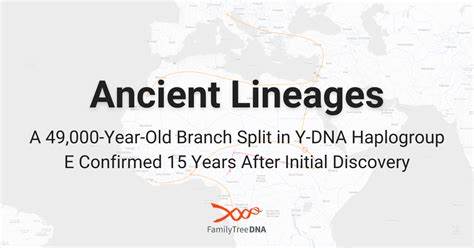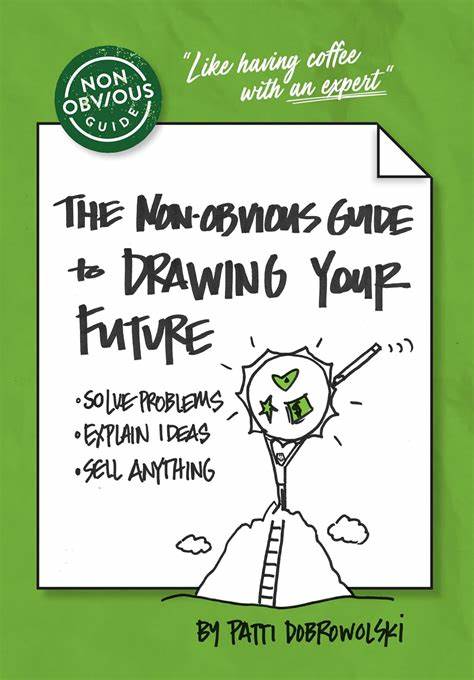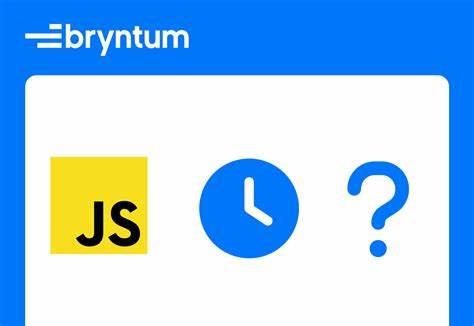Die Regulierung von Kryptowährungen, insbesondere Stablecoins, steht in den USA seit einiger Zeit im Mittelpunkt politischer Debatten. Mit der wachsenden Bedeutung digitaler Vermögenswerte hat der Gesetzgeber zwei zentrale Gesetzesvorlagen ins Leben gerufen, um für Klarheit und Kontrolle in diesem dynamischen Sektor zu sorgen: den STABLE Act und den GENIUS Act. Diese beiden Gesetzesentwürfe verfolgen unterschiedliche Ansätze in Bezug auf Regulierung, Förderung von Innovation und Verbraucherschutz. Ihre Auswirkungen können maßgeblich die zukünftige Entwicklung des Stablecoin-Markts in den Vereinigten Staaten bestimmen. Der STABLE Act, offiziell bekannt als Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy Act, wurde von den US-Abgeordneten French Hill und Bryan Steil initiiert.
Er richtet sich speziell an sogenannte „Payment Stablecoins“, also auf Fiat-Währungen wie den US-Dollar peggte Kryptowährungen, die insbesondere für Zahlungszwecke verwendet werden. Der Gesetzesvorschlag zielt darauf ab, einen klaren und umfassenden bundesweiten Rechtsrahmen für die Emission und Regulierung dieser digitalen Zahlungsmittel zu schaffen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Gewährleistung von Transparenz der Reserven, Vermeidung von Missbrauch sowie dem Schutz der Verbraucher. Wichtiges Kennzeichen des STABLE Acts ist die klare Vorgabe, dass Stablecoins zu 100 Prozent durch hochwertige liquide Vermögenswerte gedeckt sein müssen. Dazu zählen US-Dollar, kurzfristige Schatzanweisungen oder Bankeinlagen.
Diese strikte Reservepflicht soll sicherstellen, dass jeder ausgegebene Stablecoin jederzeit zum Nennwert zurückerworben werden kann – auch in Zeiten finanzieller Stresslagen. Emittenten von Stablecoins dürfen weder behaupten, eine Einlagensicherung wie die FDIC zu besitzen, noch dürfen sie solche Angaben irreführend kommunizieren. Monatsberichte über die Zusammensetzung der Reserven gehören zur Pflicht, überprüft von unabhängigen Wirtschaftsprüfern, sodass Transparenz gewährleistet wird. Verstöße gegen diese Vorschriften können mit empfindlichen Geldstrafen sowie strafrechtlichen Sanktionen geahndet werden. Besonders bemerkenswert ist die Regelung, wonach Stablecoins keine Zinsen an ihre Inhaber ausschütten dürfen.
Mit dieser Maßnahme sollen Stablecoins klar von traditionellen Spareinlagen abgegrenzt werden und systemische Risiken für das Finanzsystem reduziert werden. Zudem unterliegen die Emittenten strengen Anti-Geldwäsche-Vorschriften gemäß dem Bank Secrecy Act. Anders als traditionelle Finanzinstitute können jedoch nicht nur Banktöchter, sondern auch staatlich zugelassene Nichtbanken und qualifizierte Emittenten stabilecoins ausgeben, was einen gewissen Spielraum zur Förderung von Innovation bietet. Parallel zum STABLE Act verfolgt der GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act) einen etwas anderen Ansatz. Eingeführt von Senatoren Bill Hagerty, Tim Scott, Kirsten Gillibrand und Cynthia Lummis, hat dieser Gesetzesvorschlag das Ziel, eine umfassende Rechtsstruktur zu etablieren, die sowohl die Förderung von Innovation ermöglicht als auch den Schutz vor Risiken verbessert.
Der GENIUS Act zeigt sich flexibler in der Regulierung, indem er Emittenten von Stablecoins die Wahl zwischen bundesstaatlicher und bundesweiter Aufsicht lässt. Damit soll insbesondere kleineren und mittleren Anbietern der Marktzugang erleichtert werden, während größere Player mit einem Marktwert über zehn Milliarden Dollar automatisch unter die Bundesregulierung fallen. Der GENIUS Act verlangt ebenfalls eine vollständige 1:1-Deckung der Stablecoins durch genehmigte liquide Werte wie Bargeld und US-Schatzpapiere, die von den Emittenten detailliert offen zu legen und regelmäßig extern zu prüfen sind. Verbraucherschutz wird unter anderem dadurch gewährleistet, dass Stablecoin-Inhaber im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Emittenten gegenüber anderen Gläubigern bevorzugt behandelt werden. Der Gesetzesvorschlag definiert Stablecoins klar als keine Wertpapiere oder Finanzinvestitionsinstrumente, was Rechtssicherheit im Markt schafft.
Im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche sieht der GENIUS Act vor, dass Emittenten wie regulierte Finanzinstitute behandelt werden. Das bedeutet verpflichtende Nutzeridentifikation und Überwachung von Transaktionen mit Meldepflichten verdächtiger Aktivitäten. Die Gesetzgebung reagiert damit auf Befürchtungen, dass Kryptowährungen als Instrumente für illegale Finanzströme missbraucht werden könnten. Beide Gesetzentwürfe teilen gewisse Grundprinzipien: Sie erlauben die Emission von Stablecoins durch qualifizierte Finanzinstitute und zertifizierte nicht-bankliche Stellen, verlangen vollständige Reservedeckung und transparentere monatliche Berichterstattung von Emittenten. Zudem verpflichten sie alle Anbieter zur Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Regeln.
Der wesentliche Unterschied liegt insbesondere in der Flexibilität und dem Umgang mit algorithmischen Stablecoins. Während der STABLE Act eine zweijährige Aussetzung für algorithmisch gestützte Stablecoins vorsieht, lässt der GENIUS Act deren Verwendung unter bestimmten Bedingungen zu und kündigt zugleich weitere Untersuchungen zu potenziellen Risiken an. Auswirkungen dieser Gesetze dürften weit über die USA hinaus Bedeutung erlangen. Der STABLE Act mit seinem strengeren Regulierungsrahmen bietet eine robuste Plattform zur Förderung von Vertrauen und Sicherheit, könnte aber kleinere oder neu entstehende Anbieter durch die Einhaltung hoher Compliance-Anforderungen vor Herausforderungen stellen. Etablierte Unternehmen wie Circle oder PayPal könnten hingegen von der Klarheit und Legitimität profitieren, was die Integration von stabilen digitalen Zahlungsmitteln in traditionelle Finanzsysteme begünstigt.
Der GENIUS Act hingegen verfolgt eine duale Aufsichtspolitik, die Multiperspektivität fördert und durch die Wahlfreiheit zwischen Staaten und Bund den Innovationsgeist stärken kann. Kritiker warnen jedoch, dass die flexiblere Regulierung eine Gefahr für die Finanzstabilität und wirksame Aufsicht darstellen könnte, insbesondere wenn kleinere Emittenten eine weniger strenge Beaufsichtigung genießen. Außerdem könnte die Gesetzesvorlage durch die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen staatlichen und bundesweiten Behörden zu regulatorischer Fragmentierung führen. Im Vergleich zu anderen internationalen Regelwerken wie der europäischen MiCA-Verordnung zeigen sich weitere Besonderheiten. MiCA verfolgt einen umfassenden, einheitlichen Ansatz in der gesamten Europäischen Union, der alle Kryptowährungsarten, über Stablecoins hinaus, umfasst.
Dort gelten umfangreiche Kapitalanforderungen und harmonisierte Offenlegungspflichten für Emittenten, ergänzt durch strikte Maßnahmen zur Sicherstellung der Finanzstabilität. Die US-Vorschläge konzentrieren sich bisher stärker auf Stablecoins und erlauben eine gewisse Variabilität in der Regulierung zwischen Staaten und dem Bund. Beide US-Gesetzesentwürfe sehen sich jedoch auch mit Kritik konfrontiert. Gegner des STABLE Acts bemängeln vor allem das Fehlen einer obligatorischen Einlagensicherung und einer systematischen Erstattung bei Ausfällen oder Betrugsfällen. Staatliche Aufsichtsbehörden fürchten eine Aushöhlung ihrer eigenen Kompetenzen durch die Bundesregulierung.
Innerhalb der Krypto-Community wird die Beschränkung von zinsbringenden Stablecoins als innovationshemmend angesehen. Der GENIUS Act erlebt dagegen jüngst politische Widerstände, insbesondere durch den Rückzug einiger demokratischer Abgeordneter, die die Gesetzesvorlage für unzureichend in Verbraucherschutz und in der klaren Regulierung ausländischer Stablecoin-Anbieter halten. Die Ablösung der Kontrolle durch das Finanzministerium zugunsten eines Ausschusses sorgt zudem für Bedenken bezüglich Effizienz und Verantwortlichkeit. Politische Hindernisse verzögern die Umsetzung, was die bereits komplexe Regulierungslandschaft zusätzlich belastet. Das Ringen um einen ausgewogenen Rahmen für Stablecoins bildet somit einen zentralen Baustein in der Zukunft des US-amerikanischen Kryptowährungsmarktes.
Es spiegelt den fortwährenden Versuch wider, Innovation zu ermöglichen, während Risiken für größere Teile des Finanzsystems und der Verbraucher minimiert werden sollen. Die Antworten auf diese Herausforderungen werden nicht nur bestimmen, wie sich die digitale Ökonomie in den USA entwickelt, sondern könnten auch globale Standards setzen. Angesichts der Dynamik des Marktes bleibt es zu beobachten, wie sich diese Gesetzesentwürfe entwickeln und ob sie den technologischen Fortschritt und den Schutz der Nutzer gewinnbringend in Einklang bringen können. Die Balance zwischen strenger Regulierung und förderlichem Freiraum für neue Geschäftsmodelle wird entscheidend sein, um eine nachhaltig stabile und innovative Zahlungsinfrastruktur auf Basis von Stablecoins zu etablieren, die den US-Dollar als global führende Reservewährung im digitalen Zeitalter weiter stärkt.