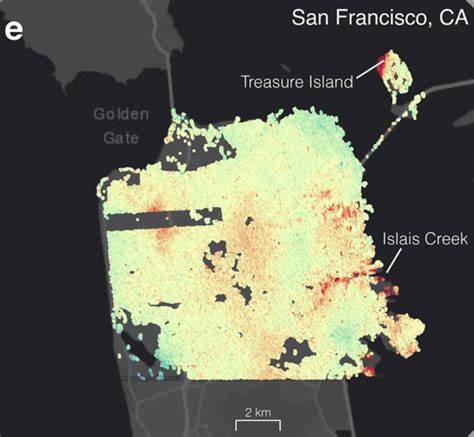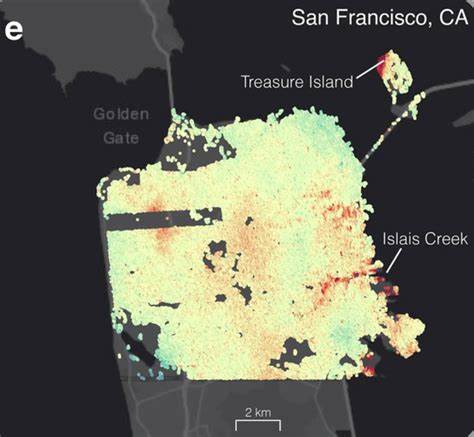Die politische Landschaft der Vereinigten Staaten befindet sich seit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 in einer Phase intensiver Spannungen und juristischer Auseinandersetzungen. Eine der kontroversesten Entwicklungen in diesem Kontext ist die menschenrechtliche und juristische Debatte um die zu milde Behandlung der Randalierer vom 6. Januar im Vergleich zur harten Strafverfolgung friedlicher Demonstranten, die vergleichsweise harmlose Protestaktionen durchführen. Diese Paradoxie steht exemplarisch für eine tiefgreifende Krise im amerikanischen Rechtssystem, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit im Umgang mit politischen Protesten erschüttert.
Im Fokus steht hierbei die Bundesregierung unter der Leitung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seines Justizministeriums, das millionenfach diskutierte Begnadigungen gegenüber 1.500 Teilnehmern des Sturmangriffs auf das Kapitol entschied. Gleichzeitig verfolgt dieselbe Verwaltung strengere Maßnahmen gegen Aktivisten, die sich gewaltfrei und zivilgesellschaftlich für demokratische Grundwerte einsetzen. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Strafverfolgung von Adam Eidinger, einem langjährigen Aktivisten, der wegen einer friedlichen Protestaktion in Washington, D.C.
mit einer Gefängnisstrafe bedroht wird – eine Demonstration, die im Vergleich zum gewalttätigen und zerstörerischen Mob des 6. Januars weit harmloser war. Adam Eidinger war Teil einer Gruppe von Demonstranten, die am 10. Januar an den historischen Säulen des National Archivs ein 12 Meter (40 Fuß) langes Banner hochgehängt hatten. Dieses Banner forderte den damaligen Präsidenten Joe Biden auf, den Gleichberechtigungszusatz, auch bekannt als Equal Rights Amendment (ERA), offiziell anzuerkennen.
Laut Eidinger verlief die Aktion friedlich und geordnet; es kam weder zu Gewalt noch zu Sachbeschädigungen oder Störungen im Innern. Die Protestteilnehmer standen im Rahmen ihrer Versammlungsrechte, die sie in der amerikanischen Demokratie ausüben wollten. Dennoch leitete die Verwaltung mit Ed Martin, dem damaligen Interim-Staatsanwalt, der zuvor Verteidiger von Angeklagten des 6. Januars war, Strafverfahren gegen Eidinger und seine Mitstreiter ein. Während andere Demonstranten, die mit Eidinger gemeinsam verhaftet wurden, mit einem sogenannten Deferred-Prosecution-Agreement (aufgeschobenes Verfahren mit Aussicht auf Einstellung) davonkamen, soll Eidinger sich nun einem Gerichtsverfahren im Oktober gegenübersehen, in dem ihm möglicherweise Gefängnis droht.
Kritiker sehen in diesem Vorgehen nicht nur juristische Ungleichbehandlung, sondern auch eine politische Botschaft, die darauf abzielt, gezielt bestimmte Protestformen zu kriminalisieren. Die Ironie des Falls wird dadurch verstärkt, dass Ed Martin politisch und juristisch tief mit der Bewegung verbunden ist, die sowohl als Anwalt von Januar-6-Verteidigern als auch als enger Verbündeter des Trump-Justizministeriums agierte. Darüber hinaus begann Martins politische Karriere in den Diensten von Phyllis Schlafly, einer bekannten konservativen Aktivistin, die sich in den 1970er Jahren gegen das ERA aussprach. Die Dualität von Begnadigungen gewalttätiger Randalierer einerseits und der Strafverfolgung friedlicher Aktivisten andererseits ist nicht nur juristisch problematisch, sondern setzt auch ein gefährliches gesellschaftliches Signal. Die Tatsache, dass Menschen wie Eidinger, die gewaltfrei protestieren und sich in langjährigem politischem Engagement üben, zur Rechenschaft gezogen werden, während andere, die mutmaßlich die Demokratie gewaltsam attackierten, unangetastet bleiben, fördert eine Wahrnehmung von Ungerechtigkeit, die das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit untergräbt.
Dieses Spannungsfeld ist auch deshalb von Relevanz, weil es weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft der protestorientierten Demokratie USA haben wird. Demonstrationen gehören seit Anbeginn der amerikanischen Geschichte zum politischen Alltag, doch das juristische Nachspiel solcher Aktionen bestimmt maßgeblich, wie aktiv die Bürger ihr Recht auf Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit wahrnehmen können. Anwälte und Juristen, die sich mit Fällen im Bereich Demonstrationsrecht befassen, erwarten, dass die juristische und gesellschaftliche Erinnerung an den 6. Januar die künftigen Gerichtsverfahren und sogar die Entscheidungen von Geschworenen prägen wird. Der Umstand, dass die Regierung unter Trump und seine Justizbehörde gewalttätige Aktionen begnadigt, kann zur sogenannten Jury-Nullifikation führen, bei der Geschworene Strafverfahren gegen friedliche Demonstranten negieren, weil sie eine politische Ungleichbehandlung wahrnehmen.
Die Folge könnte ein genereller Vertrauensverlust und eine Abschwächung der Wirksamkeit staatlicher Strafverfolgung sein, insbesondere im Bereich von zivilgesellschaftlichen Protesten. Die Rechtsexpertin Mara Verheyden-Hilliard weist darauf hin, dass es „ideologische Strafverfolgung“ sei, wenn einerseits Gewalt auf dem Kapitol zelebriert wird, während andererseits friedliche Protestaktionen verfolgt werden. Sie sieht darin eine gefährliche Verschiebung, die das Fundament von Demokratiemöglichkeiten und Grundrechten erschüttern kann. Auch zahlreiche ehemalige Staatsanwälte gehen davon aus, dass die Verteidigungslinien in Fällen wie dem von Eidinger sich auf die Ungleichbehandlung berufen und im Rahmen juristischer Verfahren den Umgang mit den Januar-6-Begnadigungen thematisieren werden – auch wenn Gerichte versuchen, solche Vergleiche nicht zuzulassen. Die unweigerlichen Parallelen zwischen den Fällen lassen sich kaum ausblenden, selbst wenn der Richter entsprechende Interventionen unterbindet.
Denn die öffentlichen Bilder und die politische Debatte sind allgegenwärtig. Das politische Klima in Washington scheint durch diesen Konflikt tief gespalten. Demokraten drängen darauf, dass Ed Martin nicht als permanenten US-Staatsanwalt bestätigt wird, denn seine Amtsführung und sein Umgang mit Januar-6-Prozessen gelten als äußerst umstritten. Selbst republikanische Senatoren wie Thom Tillis haben angekündigt, nicht für die Bestätigung zu stimmen. Insgesamt illustriert der Fall Eidinger ein Moment der politischen und juristischen Zerrissenheit in einem Land, das sich weiterhin darum bemüht, die Balance zwischen Recht und Ordnung bei gleichzeitiger Achtung der Bürgerrechte zu finden.
Der Fall fungiert als Beispiel für die Spannungen im Umgang mit politischem Aktivismus, Meinungsfreiheit und dem Gerechtigkeitsempfinden der Gesellschaft. Während der Protest für das ERA in diesem konkreten Fall Aufmerksamkeit generierte und Präsident Biden kurz nach der Aktion die Legitimität des 28. Verfassungszusatzes anerkennt, bleibt die juristische Aufarbeitung ein ungleiches Ringen. Letztendlich zeigt sich hier ein Grundproblem: Die selective Anwendung von Gerechtigkeit und Gesetz kann nicht nur den politischen Diskurs belasten, sondern auch nachhaltige Schäden für eine pluralistische Demokratie verursachen. Die Lehre aus diesem Geschehen ist, dass Rechtsstaatlichkeit und Gleichbehandlung im politischen Kontext nicht nur juristische Grundsätze sein sollten, sondern gelebte Praxis, wenn der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht gefährdet werden soll.
Adam Eidinger und seine Unterstützer sehen sich als Teil der langen Geschichte amerikanischer Bewegungen, die um Gleichberechtigung und Gerechtigkeit kämpfen. Die juristischen Herausforderungen zeigen aber, wie politisierte Justizhandlungen diese Bewegungen gleichzeitig als Bedrohung empfinden und ihnen das Recht auf zivilgesellschaftliches Engagement erschweren wollen. Die Auseinandersetzung um den sogenannten „Mardi Gras“-Prozess zeigt, dass der Januar-6-Komplex Washington und die amerikanische Gesellschaft auch Jahre nach den Ereignissen weiterhin prägt und spaltet. Die Frage, wie mit politischem Protest und Gewalt umgegangen wird, bleibt ein heiß umstrittenes Thema, das nicht nur juristische Experten, sondern auch die breite Öffentlichkeit in Atem hält. Die Geschichte von Adam Eidinger verdeutlicht die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts, in denen Rechtsstaat und Demokratie immer häufiger auf dem Prüfstand stehen – und wo die Grenzen von Gerechtigkeit und politischem Machtspiel komplexer denn je erscheinen.