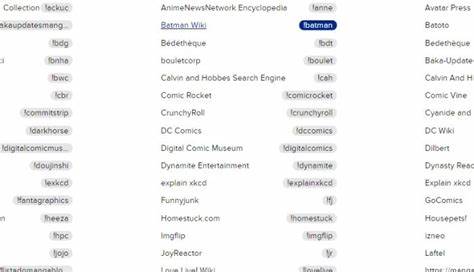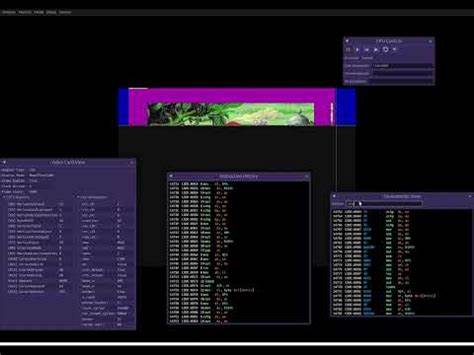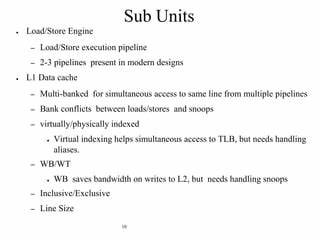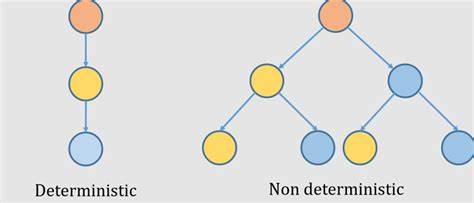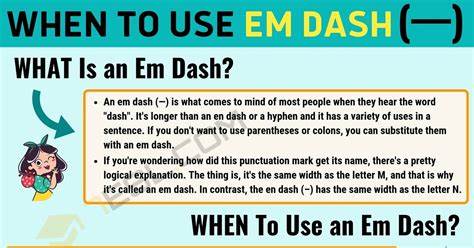Im April 2025 sorgte eine kontroverse Behauptung von Ex-Präsident Donald Trump in den sozialen Medien für Aufsehen: Er stellte in Aussicht, dass durch die von ihm eingeführten und geplanten Zölle die Einkommensteuer für viele Amerikaner, insbesondere jene mit Einkommen unter 200.000 US-Dollar jährlich, wesentlich reduziert oder sogar vollständig abgeschafft werden könnte. Laut Trump würden diese Maßnahmen finanziellen Spielraum für „den Mittelstand“ schaffen und einen echten wirtschaftlichen Aufschwung bewirken. Die fast schon radikale Hoffnung eines steuerfreien Lebens für einen Großteil der Bevölkerung trifft jedoch auf erheblichen Widerstand von Ökonomen und Steuerexperten, die die finale Rechnung anders sehen und die Auswirkungen der Zölle auf die Staatsfinanzen kritisch hinterfragen. Der Kern von Trumps Aussage basiert auf der Vorstellung, dass die Einnahmen aus erhöhten Zöllen auf Importe das Bundesbudget der Vereinigten Staaten ausreichend stärken würden, um die Einkommenssteuerbelastung weitgehend zu kompensieren.
Dadurch könnten mehr Menschen ihre Einkommensteuerlast drastisch senken oder sogar komplett abschaffen. Mit Blick auf die Einkommensverteilung in den USA ist es erwähnenswert, dass laut Daten des U.S. Census Bureau aus dem Jahr 2023 nur gut 14 Prozent der Haushalte über 200.000 Dollar Jahresverdienst verfügen, was bedeuten würde, dass die große Mehrheit der Bevölkerung potenziell von dieser Regelung profitieren könnte.
Allerdings zeigt ein genauerer Blick auf die Zahlen und die wirtschaftliche Realität ein ganz anderes Bild. Wirtschaftswissenschaftler und Experten des Steuerrechts weisen darauf hin, dass die bisherigen und geplanten Zollaufkommen mit knapp 167 Milliarden Dollar im Jahr 2025 nur einen Bruchteil der Einnahmen durch die Einkommensteuer ersetzen könnten. Aktuell generiert die individuelle Einkommensteuer im Vergleich zu den Zolleinnahmen mehr als das 27-fache an Steuererträgen für den Staat – eine gewaltige Diskrepanz, die schlicht nicht durch Zölle ausgeglichen werden kann. Um die Einkommensteuer für den genannten Kreis von Steuerzahlern vollständig zu eliminieren, wäre demnach eine signifikant höhere Einnahmequelle erforderlich, als die Zölle liefern können. Die Einführung von Zöllen führt zudem zu komplexeren wirtschaftlichen Dynamiken, die oft kontraproduktiv wirken.
Vermehrte Zölle auf importierte Waren verteuern Produkte nicht nur für Unternehmen, die auf ausländische Komponenten angewiesen sind, sondern auch für Konsumenten, die mit höheren Preisen konfrontiert werden. Dies kann sich in einer steigenden Inflation und einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums manifestieren, was letztlich die Kaufkraft der Bürger beeinträchtigt – gerade jene, die Trump eigentlich durch Steuerentlastungen entlasten wollte. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die globale Vernetzung der Wirtschaft. Handelssanktionen oder Zollerhöhungen können Reaktionen anderer Länder provozieren, die ebenfalls Zölle auf amerikanische Exporte erheben. Ein solcher Handelskrieg schadet nicht nur den internationalen Beziehungen, sondern führt oft auch zu einem Rückgang der Exporterlöse und beeinträchtigt Arbeitsplätze in betroffenen Branchen.
Die Verluste aus reduzierten Exporten könnten somit die durch die Zölle generierten Zusatzsteuern zunichte machen. Abseits der politischen Ankündigungen bleibt die steuerliche Realität für viele Amerikaner kompliziert. Einkommenssteuer ist nur eine Komponente im komplexen System staatlicher Einnahmen. Sozialabgaben, Verbrauchssteuern, Unternehmenssteuern und weitere Abgaben spielen zusammen eine Rolle im Gesamtbild der Staatsfinanzierung. Die Ankündigung, Zölle könnten die individuelle Steuerlast massiv reduzieren oder eliminieren, scheint vor dem Hintergrund dieser finanziellen Vielschichtigkeit und der realen Zahlen nüchtern betrachtet wenig plausibel.
Für Anleger und Bürger, die tatsächlich nach Möglichkeiten suchen, ihre Steuern zu optimieren, gibt es jedoch bewährte Alternativen, die zum Teil auch unabhängig von politischen Entscheidungen sind. Finanzexperten wie Scott Galloway, Professor an der New York University, empfehlen vor allem die gezielte Nutzung von Kapitalanlagen als Mittel zur Steuerreduzierung. Aktienbesitz etwa bietet die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, ohne notwendigerweise kurzfristige Steuern durch den Verkauf zu realisieren. Die Strategie, Aktien langfristig zu halten und lediglich gegen deren Wert zu beleihen, hilft, Kapitalgewinne erst einmal nicht zu versteuern und gleichzeitig Liquidität zu generieren. Die Herausforderung für die meisten privaten Steuerzahler besteht darin, dass steuerliche Vorteile oft mit einer langfristigen, strategischen Anlageplanung verknüpft sind und nicht durch kurzfristige politische Maßnahmen verändert werden können.
Gerade durch den Besitz von Vermögenswerten in Aktien, Immobilien oder anderen Anlageklassen können Steuerlasten auf legale Weise verschoben oder vermindert werden, ohne auf fragwürdige politische Versprechungen zu setzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Trumps Behauptung zur Abschaffung der Einkommensteuer durch Zölle vor allem als politisches Signal und weniger als ökonomisch fundierte Prognose zu verstehen ist. Die ökonomischen Fakten und Expertenmeinungen zeigen deutlich, dass eine solche Steuerentlastung durch alleinige Zollerhöhung finanziell nicht machbar wäre. Vielmehr bestehen Risiken für die Wirtschaft, den Handel und letztlich auch für die Konsumentenpreise. Wer tatsächliche Steueroptimierungen anstrebt, sollte sich besser mit bewährten Strategien der Vermögensbildung und -verwaltung auseinander setzen.
Zusätzliche politische Maßnahmen oder Reformen im Steuersystem wären notwendig, um substanzielle Entlastungen für breite Bevölkerungsschichten zu bewirken. Die einfache Rechnung, Zölle gegen Einkommensteuern aufzurechnen, greift zu kurz und unterschätzt die komplexen volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. Steuerpolitik bleibt ein vielschichtiges Feld, das sowohl wirtschaftliche Daten als auch soziale Fairness berücksichtigen muss. Die spannende Debatte um Zölle und Steuern wird daher aller Voraussicht nach auch in Zukunft Thema intensiver Diskussionen bleiben.