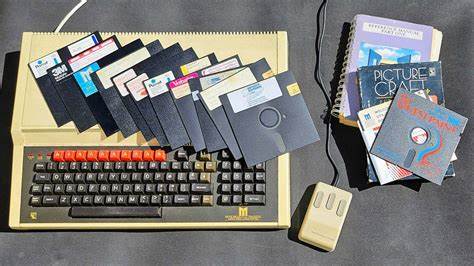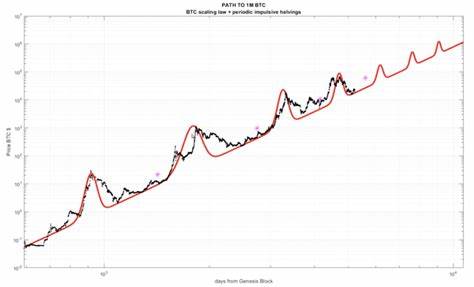Eine Website zu erstellen ist für viele Menschen eine herausfordernde Aufgabe. Besonders für diejenigen, die sich selbst an Webdesign versuchen, kann das Ergebnis häufig „hässlich“ oder unprofessionell wirken – zumindest im eigenen Urteil oder im Vergleich mit kommerziellen Seiten. Doch gerade diese subjektive Ästhetik und der Mut, den eigenen digitalen Raum persönlich zu formen, bergen einen besonderen Wert. Denn meine Website ist hässlich, weil ich sie selbst gemacht habe – und genau darin liegt ihre Einzigartigkeit und Authentizität. In der heutigen Zeit sind wir umgeben von perfektionierten Oberflächen, professionellen Designs und makellosen Layouts.
Doch dabei gehen oft die Seele und die Persönlichkeit der Menschen hinter der Website verloren. Wenn meine Mutter sich Kunst für den Kühlschrank wünscht, dann will sie keine Reproduktionen von berühmt-berüchtigten Meistern wie Vermeer oder Lichtenstein, sondern eben meine Kunst. Das gilt auch für das digitale Ebenbild unseres kreativen Schaffens – eine Website kann technisch ausgereift und visuell ansprechend sein, doch ohne die persönliche Note bleibt sie leer und austauschbar. Der Drang, eine eigene Website zu entwickeln, entspringt einer inneren Motivation – einem inneren „Jucken“ oder Bedürfnis, Inhalte, Gedanken und Emotionen in die digitale Welt zu bringen, wie nur man selbst es kann. Vielen ist das zu aufwendig: den Server zu managen, die technische Infrastruktur zu pflegen, eigene Designentscheidungen zu treffen oder sogar darüber hinaus Kunst und Struktur zu schaffen.
Doch genau das macht den Reiz aus: Es ist nicht nur ein Werkzeug zur Informationsvermittlung, sondern ein Ausdruck der eigenen Identität. Dabei sprechen wir nicht von einer professionellen Agentur, die die neuesten Trends kennt und mit großem Budget die Website perfekt gestaltet. Es geht um die Freude am Selbermachen, um das Experimentieren mit HTML, CSS und jeder Form digitaler Gestaltung, die man sich zutraut. Dieses Selbermachen führt nicht selten zu einem Endprodukt, das Designstandards ignoriert, mit Unregelmäßigkeiten spielt und gerade dadurch Charakter gewinnt. Ich wollte eine Website, die nicht steril und klinisch wirkt, sondern voller Leben steckt – eine Website, die aussieht und sich anfühlt wie ein Gebrauchtbuchladen oder ein antikes Kabinett, in dem vieles zusammenkommt und die Geschichte erzählt, wie sie entstanden ist.
Das begann bei der Architektur der Navigation. Statt die üblichen horizontalen oder vertikalen Menüs zu wählen, entschied ich mich für ein ungewöhnliches Layout, in dem Elemente unterschiedlich gedreht sind und in Schriftarten variieren. Das mag für Besucher zunächst irritierend erscheinen, erzeugt aber gleichzeitig Spannung und visuelle Dynamik. Meine Wahl, bei der Gestaltung zufällige Rotationseffekte und eine Mischung von Schriftarten einzusetzen, widerspricht allen gängigen Regeln des Webdesigns. Doch so wird aus einem einfachen Navigationsmenü ein Erlebnis, das den Besucher zum Verweilen einlädt – oder zum Schmunzeln bringt.
Diese bewusst herbeigeführte „Unordnung“ auf der Webseite ist kein Versehen, sondern ein entschiedenes Statement gegen das sterile, perfekt ausbalancierte Design, das oft als standardisierte Norm diktiert wird. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass das Digitale Raum für Kreativität, Emotionen und Fehler sein darf – ja sogar muss. Die Webseite wird so zur Leinwand, auf der das durchaus kindliche, experimentelle Wesen der persönlichen Gestaltung sichtbar wird. Die Idee, die Website so zu gestalten, dass sie auf Mausbewegungen ohne den Einsatz von JavaScript reagiert, unterstreicht den Wunsch nach Einfachheit und gleichzeitig spielerischer Interaktion. Dabei helfen reine CSS-Techniken, kleine Bewegungen oder Effekte zu erzeugen, die den Eindruck eines „Berührens“ der Website vermitteln.
Dieses Gefühl verbindet das Digitale mit dem Haptischen, eine Art Interaktion, die traditionelle Medien nicht leisten können. Der Einsatz von Textur ist ein weiterer Aspekt, der die Website unverwechselbar macht. Anstatt eines glatten, weißen Hintergrunds, wie man ihn von vielen minimalistischen Seiten kennt, nutze ich eine synthetisierte Struktur, die entweder wie Staub auf Papier wirkt oder als Sternenhimmel. Gerade diese feinen Details schaffen Atmosphäre. Im Gegensatz zum üblichen weißen Raum entsteht eine Art von Tiefe und Realität.
Die Website fühlt sich dadurch weniger virtuell und künstlich an, sondern lebendig und greifbar – wie ein Buch, das man öffnen, fühlen und erleben kann. Die Ästhetik einer Website entscheidet sich nicht allein durch technisch perfekte Umsetzung oder die Einhaltung von Designkonventionen. Vielmehr liegt die Schönheit oft im Unvollkommenen, im Persönlichen. Was einige als hässlich wahrnehmen, ist für andere Ausdruck von Echtheit. Es geht nicht darum, eine makellose Oberfläche zu bieten, sondern einen Platz zu schaffen, an dem man sich selbst wiedererkennt und der Raum für Wandel bietet.
Denn genauso wie Menschen sich ständig verändern, sollte auch eine persönliche Website niemals statisch sein. Sie durchläuft genauso viele Entwicklungsphasen, wie wir selbst. Was heute noch als chaotisch empfunden wird, kann morgen bereits Ausdruck einer neuen Leidenschaft oder eines veränderten Geschmacks sein. Das eigene digitale Zuhause zu pflegen bedeutet auch, es wachsen zu lassen, Fehler zu akzeptieren und immer wieder neu zu formen. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch die Beziehung zum Besucher.
Oftmals fühlen wir uns gedrängt, eine Website so professionell und „perfekt“ wie möglich zu gestalten, um Vertrauen zu schaffen oder Autorität auszustrahlen. Doch gerade die Echtheit, die persönliche Handschrift, kann viel mehr Nähe erzeugen als glatte Corporate-Seiten. Menschen stoßen oft auf Websites, die sie auf ehrliche Weise ansprechen, sie zum Nachdenken anregen oder ihnen eine andere Perspektive auf das Internet bieten. Das ist ein größerer Gewinn als eine austauschbare Oberfläche. Selbstverständlich ist es auch legitim, eine Website von Fachleuten gestalten zu lassen, wenn man bestimmte Erwartungen erfüllt wissen möchte.
Doch niemand sollte sich dafür schämen, eine selbst gebastelte Seite zu präsentieren – im Gegenteil. Sie ist ein Statement gegen das normierte Web und für die Vielfalt, die das Netz so einzigartig macht. Gerade in einer Zeit, in der beeindruckend hochglänzende Websites eher die Norm sind, braucht es mehr mutige Nischenprojekte, die zeigen, wie vielfältig und individuell das Internet sein kann. Selbstgemachte Websites erzählen Geschichten. Sie lassen Rückschlüsse darauf zu, was ihre Betreiber denken, lieben oder ablehnen.
Sie zeigen, dass hinter digitalen Schnittstellen Menschen mit ganz persönlichen Eigenheiten stehen, die ihre Spuren hinterlassen. In meinem Fall mag meine Website vielleicht nicht der Inbegriff ästhetischer Harmonie sein, doch sie ist unverkennbar meine eigene. Und das ist ein Wert, den ich über professionelles Design stelle. Um heute im Internet wahrgenommen zu werden, ist eine ansprechende Gestaltung zweifellos hilfreich. Dennoch gewinnt man mit einer authentischen Webpräsenz oft mehr Sympathien als mit der perfekt durchgestylten Fassade.
Menschen sehnen sich nach Geschichten hinter dem Medium, nach Unvollkommenheit, die menschlich macht und Verbindung schafft. Meine Website „hässlich“ zu nennen ist vielleicht überspitzt – sie ist unperfekt, verrückt, experimentell, lebendig. Und eben genau so möchte ich das. Im Endeffekt zeigt das Erlebnis meiner selbstgebauten Website eine größere Wahrheit über das Webdesign: Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber vor allem auch im Herz des Machers. Das Internet ist kein Museum perfekter Dinge, sondern ein lebendiger Ort des Austauschs, der Vielfalt und der Persönlichkeit.
Wer seine Website selbst macht, trägt dazu bei, dass das Netz nicht nur ein Ort technischer Innovationen, sondern auch menschlicher Geschichten bleibt.