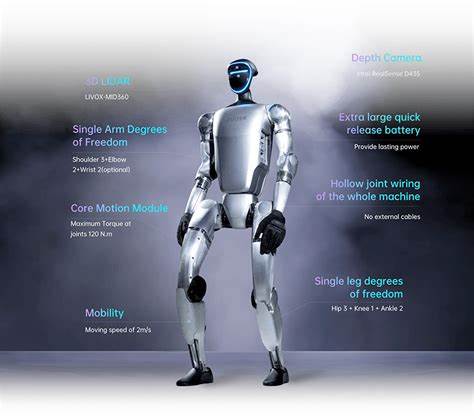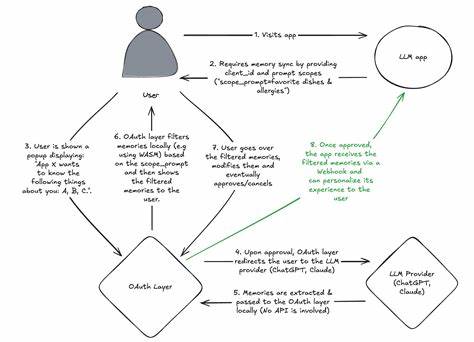Für viele Menschen ist Aufstoßen eine ganz normale körperliche Funktion, die Erleichterung verschafft und Überschussgas aus dem Magen ableitet. Doch für eine kleine Gruppe Betroffener ist genau das nicht möglich. Eine seltene Erkrankung, die das Aufstoßen verhindert, führt nicht nur zu körperlichen Beschwerden, sondern kann auch das soziale Leben erheblich einschränken und was für viele einfach scheint – das spontane Aufstoßen – wird zur Quelle von Scham und großem Leidensdruck. Trotz der scheinbar einfachen Thematik ist diese Krankheit nach wie vor wenig bekannt und häufig wird Betroffenen nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Die Folge sind Missverständnisse, lange Diagnosephasen und oft auch die falsche Behandlung.
Diese seltene Störung, medizinisch unter Bezeichnungen wie „Retrognathie der unteren Speiseröhre“, „Achalasie“ oder im Volksmund als „Stillhalten des Aufstoßens“ genannt, ist dadurch gekennzeichnet, dass Betroffene innerhalb oder außerhalb des Magens entstehende Gase nicht durch das Aufstoßen loswerden können. Während die meisten Menschen durch das Öffnen des unteren Speiseröhrenschließmuskels, auch untere Ösophagussphinkter genannt, überschüssige Luft einfach ausstoßen, bleibt Betroffenen dieser Reflex versagt. Die Ursachen dafür sind vielfältig und reichen von komplexen neurologischen Störungen über muskuläre Fehlfunktionen im Bereich der Speiseröhre bis hin zu unbekannten Idiopathien, bei denen die genaue Ursache bislang nicht geklärt ist. Die Auswirkungen für die Betroffenen sind drastisch. Der angesammelte Druck durch die im Magen eingeschlossene Luft verursacht nicht nur ein unangenehmes Völlegefühl, sondern geht meist auch mit starken Schmerzen einher.
Die Beschwerden können von dumpfen Druckgefühlen bis hin zu krampfartigen Schmerzen im Oberbauch reichen, die sogar Übelkeit und Erbrechen auslösen können. Auf Dauer können sich außerdem Schluckbeschwerden oder ein Gefühl der Enge in der Speiseröhre einstellen, da die angesammelten Gase Druck auf umliegende Organe ausüben. Neben den körperlichen Symptomen sind die sozialen Folgen für Betroffene oft dramatisch. Da Aufstoßen in vielen Kulturen eine alltägliche und unvermeidbare Körperfunktion darstellt, fühlen sich die Patienten oft isoliert und unverstanden. Der fehlende „normale“ Luftaustausch führt dazu, dass Betroffene ständig den Druck im Oberbauch spüren, was zu unangenehmen Geräuschen oder sichtbar aufgeblähtem Bauch führen kann.
Aus Angst vor peinlichen Situationen und sozialer Ablehnung ziehen sich viele Betroffene zurück, vermeiden gesellschaftliche Treffen oder bevorzugen Situationen, in denen sie sich unbeobachtet fühlen. Diese soziale Isolation verstärkt psychische Belastungen und kann zu Angstzuständen und Depressionen führen. Die Diagnose dieser Erkrankung stellt eine Herausforderung dar. Da die Symptomatik selten ist und viele Ärzte mit den speziellen klinischen Manifestationen nicht vertraut sind, dauert es häufig lange, bis Betroffene eine genaue Diagnose erhalten. Die Diagnose wird meist durch eine Kombination aus Anamnese, klinischer Untersuchung und bildgebenden Verfahren gestellt.
Spezielle Tests der Speiseröhrenfunktion, wie die manometrische Untersuchung, können den fehlenden oder reduzierten Verschluss des unteren Speiseröhrenschließmuskels aufzeigen. Zusätzlich helfen endoskopische Untersuchungen, andere Ursachen wie Entzündungen oder Tumore auszuschließen. Therapien orientieren sich an den Ursachen und reichen von medikamentösen Behandlungen bis hin zu innovativen medizinischen Eingriffen. Schmerzmittel und Krampflöser können kurzfristig Erleichterung verschaffen, aber lösen das grundsätzliche Problem nicht. In einigen Fällen zeigen sich Erfolge mit neuromuskulären Behandlungen, bei denen gezielt die Muskulatur der Speiseröhre stimuliert oder entspannt wird.
In schwerwiegenden Fällen kann eine endoskopische Myotomie durchgeführt werden, bei der der Muskelring des unteren Ösophagussphinkters chirurgisch geschnitten wird, um das Aufstoßen zu ermöglichen. Diese Behandlung birgt jedoch Risiken und ist nicht für jeden Patienten geeignet. Neben der medizinischen Behandlung ist die psychologische Betreuung von großer Bedeutung. Da Betroffene oftmals unter sozialer Isolation und negativen Gefühlen leiden, helfen Gesprächstherapien und Selbsthilfegruppen, den Umgang mit der Erkrankung zu erlernen und psychische Belastungen zu mindern. Das Gefühl verstanden zu werden und Austausch mit Betroffenen macht vielen Mut und verbessert ihre Lebensqualität erheblich.
Die Forschung zu dieser Erkrankung steht noch am Anfang. Aufgrund der Seltenheit der Krankheit und mangelnder Bekanntheit in der Öffentlichkeit gibt es bislang nur wenige Studien und wissenschaftliche Erkenntnisse. Internationale Experten arbeiten jedoch daran, die Pathomechanismen besser zu verstehen und effizientere, individuell zugeschnittene Therapien zu entwickeln. Neue Technologien und Methoden wie die hochauflösende manometrische Untersuchung und innovative endoskopische Verfahren eröffnen vielversprechende Möglichkeiten. Wichtig ist auch, das Bewusstsein für diese seltene Erkrankung zu erhöhen.
Eine frühzeitige Diagnose und eine ganzheitliche Behandlung können das Leiden der Betroffenen erheblich mindern. Ärzte und Therapeuten sollten geschult werden, um Symptome frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln. Auch Angehörige und das soziale Umfeld spielen eine wichtige Rolle dabei, Betroffene zu unterstützen und Stigmatisierung entgegenzuwirken. Das Aufstoßen, so trivial es auch erscheinen mag, ist für den Körper eine lebenswichtige Funktion, die bei manchen Menschen durch diese seltene Erkrankung komplett blockiert ist. Der Weg zu einer Besserung ist zwar oft lang und mit Herausforderungen verbunden, aber mit medizinischer Expertise, psychologischer Unterstützung und gesellschaftlichem Verständnis kann Betroffenen geholfen werden, ihren Alltag wieder mehr Lebensqualität zu verleihen.
Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass die Erkrankung mehr Aufmerksamkeit bekommt, um frühzeitig erkannt zu werden und Betroffenen neue Wege zur Heilung und zum Umgang eröffnet werden.