Die Halbleiterindustrie steht vor einer bahnbrechenden Revolution, ausgelöst durch eine wegweisende Entwicklung der Forscher an der Penn State Universität. Zum ersten Mal ist es gelungen, einen komplett aus atomdünnen zweidimensionalen Materialien gefertigten Computer zu bauen, der herkömmliches Silizium in CMOS-Technologie vollständig ersetzt. Dieser Fortschritt ist nicht nur eine technische Meisterleistung, sondern stellt auch einen Paradigmenwechsel in der Elektronik her, mit weitreichenden Folgen für die Zukunft von Smartphones, Computern, Elektrofahrzeugen und weiteren Anwendungen. Der neue 2D-Computer nutzt die einzigartigen Eigenschaften von molybdändisulfid und tungstendiselenid, zwei Halbleitermaterialien, die nur eine Atomlage dick sind. Während Silizium seit Jahrzehnten als das Herzstück der Elektronik gilt, stößt es zunehmend an physikalische Grenzen, vor allem wenn die Miniaturisierung von Transistoren weiter voranschreitet.
Bei extrem kleinen Dimensionen nehmen Leistungseinbußen zu, und Effizienzverluste machen den Betrieb energieintensiv und vielfältig beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu zeichnen sich zweidimensionale Materialien durch ihre atomare Dünne aus, die ihre elektronischen Eigenschaften auch auf kleinstem Raum beibehält. Molybdändisulfid kommt als n-Typ-Transistoren zum Einsatz, während tungstendiselenid für p-Typ-Transistoren verwendet wird. Diese Kombination ermöglicht die Konstruktion eines CMOS-Computers, der üblicherweise beide Transistortypen benötigt, um energieeffizienten und leistungsstarken Betrieb sicherzustellen. Das Team um Professor Saptarshi Das demonstrierte erstmals, dass sich aus diesen 2D-Materialien mehr als 2.
000 Transistoren herstellen lassen, die zusammen die Ausführung von logischen Operationen ermöglichen. Bei der Herstellung kam die Methode der metal-organischen chemischen Gasphasenabscheidung (MOCVD) zum Einsatz, mit der jeweils großflächige Schichten der verwendeten Materialien erzeugt wurden. Dies bildet die Grundlage für eine Fertigung, die sich von der herkömmlichen Siliziumprozessierung unterscheidet und durch hohe Präzision und Skalierbarkeit besticht. Die von den Forschern gefertigten Transistoren sind in der Lage, bei niedrigen Versorgungsspannungen mit minimalem Energieverbrauch zu arbeiten. Obwohl die Betriebsgeschwindigkeit von etwa 25 Kilohertz im Vergleich zu traditionellen Silizium-CMOS-Schaltungen noch gering erscheint, handelt es sich bei dem entwickelten Prototypen um einen sogenannten One Instruction Set Computer (OISC), welcher grundlegende logische Operationen demonstriert.
Die Ergebnisse zeigen jedoch bereits einen vielversprechenden Weg für die Zukunft der Elektronik mit 2D-Technologie. Das Forschungsprojekt spiegelt den rasanten Fortschritt wider, der seit der Entdeckung und ersten gezielten Nutzung von 2D-Materialien etwa seit 2010 stattgefunden hat. Während sich die Siliziumtechnik über etwa 80 Jahre entwickelt hat, eröffnen atomdünne Werkstoffe neue Möglichkeiten zur Integration von immer feineren und effizienteren Komponenten in elektronischen Geräten. Die Bedeutung dieser Entwicklung liegt besonders in der Aussicht, die Belastungen der Miniaturisierung zu überwinden, die für traditionelle Halbleiter an technische und physikalische Grenzen stößt. 2D-Materialien bieten nicht nur eine extrem schlanke Bauweise, sondern könnten auch zu schnelleren Schaltzeiten und deutlich niedrigeren Energieverbräuchen führen, was sich in einer längeren Batterielaufzeit, geringerer Wärmeentwicklung und insgesamt nachhaltigeren Elektronik niederschlagen kann.
Neben der grundlegenden Arbeit am CMOS-Computer umfasst die Forschung auch die Entwicklung eines detaillierten Computermodells, das die Leistung des neuartigen Systems präzise prognostiziert. Dieses Modell berücksichtigt variationsbedingte Differenzen zwischen einzelnen Transistoren und ermöglicht so eine realistische Einschätzung der Skalierbarkeit und Vergleichbarkeit mit der etablierten Siliziumtechnologie. Der Bau eines vollständig funktionalen Computers aus 2D-Materialien eröffnet zugleich Fragestellungen und Herausforderungen. Neben der Steigerung der Betriebsgeschwindigkeit gilt es, die Fertigungsprozesse weiter zu optimieren und zu industrialisieren, um eine breite Anwendung und Integration in kommerzielle Produkte zu ermöglichen. Die Forschungseinrichtung 2D Crystal Consortium Materials Innovation Platform (2DCC-MIP) an der Penn State unterstützt dabei mit modernster Infrastruktur.
Diese Entwicklung im Bereich der CMOS-Technologie hat das Potenzial, nicht nur die Elektronikbranche zu revolutionieren, sondern auch die gesamte moderne Informations- und Kommunikationstechnologie umzuwälzen. Die Aussicht auf Computer und elektronische Bauteile, die nur einen Atomdicken liegen, aber dennoch leistungsstark und energieeffizient sind, weckt Erwartungen an neue Generationen intelligenter Geräte mit verbesserten Funktionen, kleinerem Formfaktor und längeren Laufzeiten. Die Wissenschaftsgemeinschaft sieht in diesem Fortschritt auch die Möglichkeit, neue Forschungsfelder voranzutreiben, etwa im Bereich von Spintronik, der Quantenelektronik und weiteren innovativen Technologien, die zweidimensionale Materialien durch ihre besonderen Eigenschaften ermöglichen. So könnte der Durchbruch bei 2D-CMOS-Computern dazu führen, dass noch grundlegend neuartige elektronische Prinzipien und Architekturmodelle entwickelt werden. Zusammenfassend stellen die Forschungen der Penn State Universität einen historischen Schritt weg von der jahrzehntelangen Übermacht von Silizium in der Elektronik dar.
Mit der Herstellung des ersten funktionsfähigen Computers aus atomdünnen Materialien wurde ein Meilenstein erreicht, der die Vision einer neuen Ära der Halbleitertechnik ermöglicht. Im Zuge der weiteren Optimierung und Industrialisierung dieser Technologie könnte die Elektronik der Zukunft deutlich schlanker, schneller und zugleich energieschonender werden – ein Fortschritt, der die Digitalisierung und den technologischen Wandel weltweit nachhaltig prägen wird.
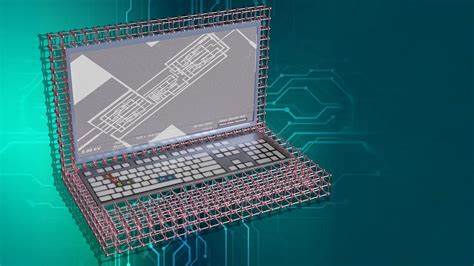




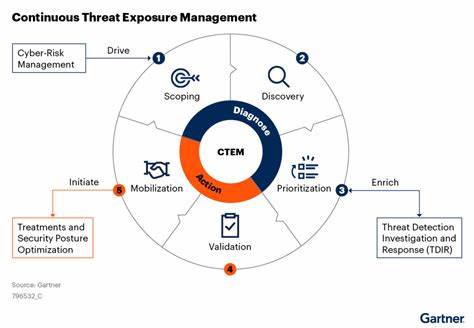
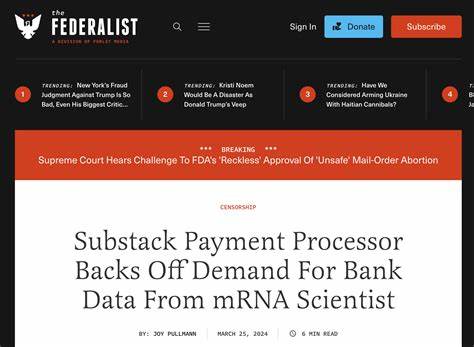
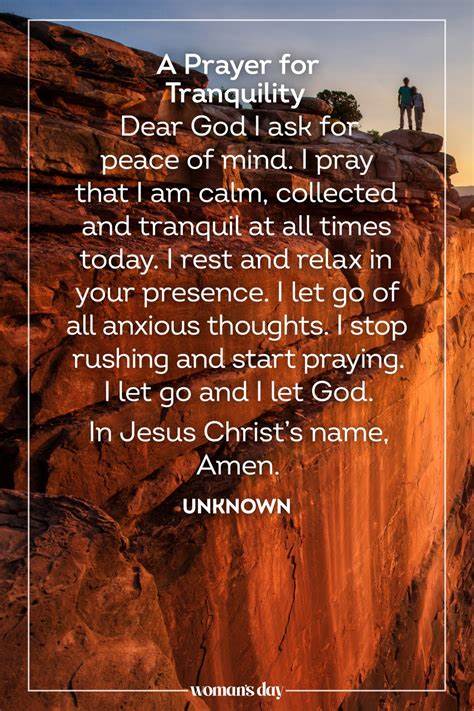
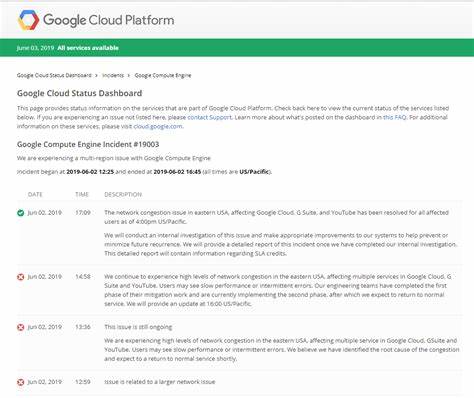
![Video Filters You've Been Lied to About Roads for 60 Years [video]](/images/A43B2732-2B2C-4057-B3B9-808D1C8E2B92)