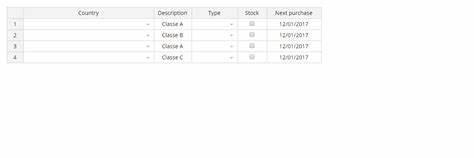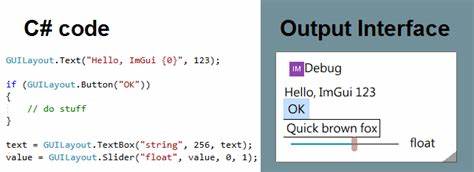Scrum ist seit vielen Jahren eine der populärsten Methoden im Bereich der agilen Softwareentwicklung. Das Framework verspricht Transparenz, eine enge Vernetzung zwischen Entwicklungsteams und den Business-Verantwortlichen sowie die Fähigkeit, schnell und flexibel auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren. Doch wie bei vielen Managementpraktiken zeigt sich oft, dass die Theorie weit über den Alltag hinausgeht. Hier kommt der Begriff „Dark Scrum“ ins Spiel, der die Schattenseite der sonst so vielversprechenden Methodenwelt beschreibt. Dark Scrum ist kein eigener Ansatz, sondern ein kritischer Begriff, der eine Reihe von Fehlentwicklungen und Missverständnissen innerhalb von Scrum beschreibt.
Es geht dabei um Situationen, in denen Scrum zwar formal angewendet wird, die zugrundeliegenden Werte und Prinzipien jedoch untergraben werden. Entwickler erleben in diesen Umgebungen oft Druck, Kontrolle und mangelnde Wertschätzung, was zu einem dysfunktionalen Arbeitsumfeld führt. Einer der Kernpunkte bei Dark Scrum ist die Verweigerung echter Selbstorganisation. Scrum setzt konsequent darauf, dass Teams eigenverantwortlich planen und umsetzen. Doch in der Praxis kommt es häufig vor, dass Führungskräfte oder sogenannte „Power Holder“ die Kontrolle nicht abgeben und stattdessen täglich als Kontrolleur auftreten.
Die berühmte „Daily Scrum“-Besprechung, die eigentlich das Team befähigen soll, den Tag selbst zu strukturieren, wird so zur Bühne für Mikromanagement und Schuldzuweisungen. Die Folge ist ein Klima von Misstrauen und Angst. Teams werden nicht als kompetente Erfüllungsgehilfen behandelt, sondern als Problemquellen, die ständig überwacht werden müssen. Anstatt gemeinsam als Einheit Lösungen zu entwickeln, entsteht ein „Wir gegen Sie“-Gefühl. Diese Dynamik steht im starken Widerspruch zu den agilen Werten von Vertrauen, Respekt und offener Kommunikation.
Ein weiterer Aspekt von Dark Scrum besteht darin, dass der Product Owner oft nicht ausreichend ausgebildet oder verstanden wird. In gut funktionierenden Scrum-Teams ist der Product Owner die Schnittstelle zwischen Business-Anforderungen und Entwicklung und sorgt dafür, dass die Prioritäten klar und nachvollziehbar sind. Sind diese Rollen jedoch schlecht besetzt oder nicht geschult, scheitert die Produktentwicklung häufig daran, dass Anforderungen entweder unklar oder unrealistisch gesetzt werden. Power Holder, meist aus dem traditionellen Management, tendieren dazu, die Entwickler mit zu vielen Aufgaben zu überladen. Sie diktieren Inhalte und Zeitpläne, ohne die technische Machbarkeit oder den Zustand des Codes angemessen zu berücksichtigen.
Dies führt zu Überforderung und einem kontinuierlichen Gefühl des Scheiterns, was durch negative Rückmeldungen etwa beim Sprint Review oder in Retrospektiven noch verstärkt wird. Statt den Fokus auf Verbesserungen und Lernen zu legen, verwandeln sich Retrospektiven in Schuldzuweisungsrunden. Entwickler werden aufgefordert, produktiver zu werden, Tests oder Refactoring seien zeitraubende Luxuswünsche, die keinen Platz im hektischen Alltag haben. Das Ergebnis ist ein Teufelskreis aus hoher Belastung, schlechter Codequalität und mangelndem Vertrauen. Wie lässt sich dieser destruktive Kreislauf durchbrechen? Ein entscheidender Hebel ist die Sichtbarkeit und Transparenz der tatsächlich geleisteten Arbeit.
Wenn Teams in der Lage sind, gut getestete, integrierte und funktionsfähige Produktinkremente am Ende jedes Sprints zu präsentieren, sinkt die Angst der Führungskräfte und damit der Druck auf Entwickler automatisch. Sichtbare Erfolge schaffen Vertrauen und legitimieren den Bedarf an iterativem und inkrementellem Arbeiten. Die Herstellung solcher funktionsfähiger Produktinkremente erfordert spezielle Praktiken, die häufig über reine Scrum-Grundlagen hinausgehen. Testgetriebene Entwicklung (TDD) stellt eine bewährte Methode dar, um die Qualität ständig zu sichern und sich mit kleinen Schritten auf funktionsfähige Software zuzubewegen. Außerdem wird durch kontinuierliche Integration sichergestellt, dass alle Teile des Systems jederzeit zusammenarbeiten und getestet sind.
Ein besonderes Werkzeug, um Missverständnisse zu vermeiden, sind gemeinsam vereinbarte Akzeptanzkriterien und ausführbare Akzeptanztests. Diese definieren eindeutig, was unter „fertig“ zu verstehen ist und verhindern lange Diskussionen darüber, ob ein Feature tatsächlich die Anforderungen erfüllt. Auf diese Weise erhöhen sich die Chancen, verbindliche Ergebnisse zu liefern, die vom Product Owner akzeptiert werden. Auch das Thema inkrementelles Design wird sehr wichtig. Da nicht alle Anforderungen von Beginn an komplett definiert sind, muss das Design der Software im Laufe der Entwicklung wachsen und sich verbessern.
Refactoring unterstützt dabei, die Softwarearchitektur kontinuierlich zu verbessern, ohne Funktionalitäten zu brechen. Nicht selten fehlt in Dark Scrum solcher Fokus auf Codequalität und Designpflege, was mittelfristig zu technischen Schulden und steigender Komplexität führt. Aber nicht nur technische Praktiken sind entscheidend. Um Dark Scrum in ein positives Scrum-Erlebnis zu verwandeln, müssen auch die Werte wie Respekt, Mut und Offenheit gelebt werden. Führungskräfte müssen lernen, Kontrolle abzugeben und den Teams wirklich zu vertrauen.
Das bedeutet auf der Führungsebene auch, Unsicherheiten zu akzeptieren und Fehler als Teil des Lernprozesses zu sehen. Schulungen für alle Beteiligten sind ein weiterer wichtiger Schritt. Viele Menschen übernehmen neue Rollen innerhalb von Scrum, ohne deren tiefere Bedeutung und Anforderungen wirklich verstanden zu haben. Wenn Power Holder, Product Owner und ScrumMaster unzureichend geschult sind, fällt es ihnen schwer, sich auf die agilen Werte einzulassen und sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Investitionen in Qualifizierung und Coaching können hier viel bewirken.
Für Entwickler gibt es auch Handlungsmöglichkeiten, sich gegen die Schattenseiten von Dark Scrum zu wehren. Wichtig ist es, die eigene Arbeit sichtbar zu machen und Führungskräften Transparenz etwa über den Stand der Software und Qualität zu verschaffen. Wenn die Führungskräfte die Realität besser verstehen, nehmen Druck und Misstrauen oft ab. Darüber hinaus sollten Entwickler aktiv auf die Einführung von agilen Engineering-Praktiken drängen und dabei langfristige Vorteile für Stabilität und Geschwindigkeit betonen. Auch das Fördern eines offeneren Dialogs und das Einbringen von Lösungsvorschlägen für typische Engpässe kann dazu beitragen, negative Dynamiken aufzulösen.