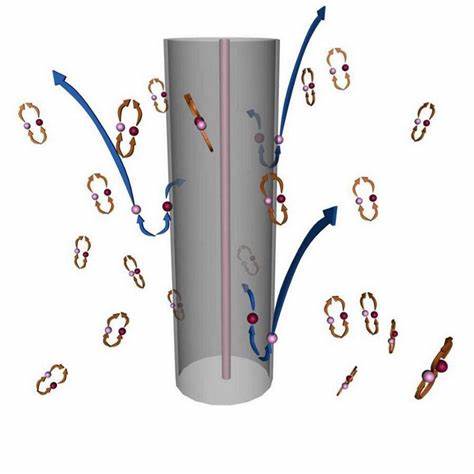Die akademische Welt steht oft vor einer Herausforderung, die vielen Studierenden und Lehrenden erst spät bewusst wird: Warum ist der Lehrplan häufig geprägt von weißen, männlichen und heterosexuellen Perspektiven? Trotz wachsendem gesellschaftlichem Bewusstsein für Diversität und Gleichberechtigung zeigt sich in vielen Curricula eine mangelnde Repräsentation marginalisierter Gruppen. Dieses Phänomen ist nicht nur auf bestimmte Regionen oder Fächer beschränkt, sondern lässt sich über verschiedene Disziplinen hinweg beobachten. Doch warum entsteht eine solche Einseitigkeit und vor allem, wie kann man sie überwinden? Es ist wichtig, sich zunächst mit den Hintergründen auseinanderzusetzen, bevor man Lösungsansätze erörtert.Oft ziehen Lehrende und Universitäten unbewusst an bereits etablierten Traditionen und überlieferten Kanon: die sogenannten „Dead White European Males“ (DWEMs), also tote weiße europäische Männer. Diese Gruppe prägt seit Jahrhunderten das akademische Denken und die kulturellen Institutionen.
Das ärgert besonders Menschen, die Diversität und Inklusion als essenzielle Werte betrachten. Doch diese Dominanz entstand nicht automatisch, sondern ist das Ergebnis historischer, sozialer und politischer Strukturen, die bestimmte Stimmen systematisch förderten und andere ausgrenzten. Diese Hegemonie wird durch den sogenannten „Status Quo“ aufrechterhalten, da Lehrpläne oft von denen gestaltet werden, die selbst innerhalb dieses Systems ausgebildet wurden. Wenn Professoren und Dozenten selbst in ähnlichen Umgebungen lernten, neigen sie dazu, auf ihr vertrautes Wissen zurückzugreifen, vor allem in Zeiten von Zeitdruck und Überforderung.Es ist also keine Frage von bösem Willen oder bewusster Diskriminierung, wenn Curricula diese unausgewogene Zusammensetzung aufweisen.
Vielmehr ist es ein Effekt von Praktikabilität, Routinen und unbewusster Trägheit in akademischen Strukturen. Eine Diversifizierung des Lehrplans erfordert daher einen aktiven, bewussten und oft zeitintensiven Einsatz von Lehrenden, die bereit sind, aus ihrer Komfortzone herauszutreten, neue Literatur zu entdecken und einzubeziehen. Dies kann mit erheblichen Mehraufwänden verbunden sein, die in der aktuellen Landschaft der universitären Überlastung eine große Hürde darstellen.Darüber hinaus spielt die Disziplin, in der man arbeitet, eine wesentliche Rolle. Einige Fächer – wie Gender Studies, Postkoloniale Literatur oder Queer Theory – legen ihren Fokus explizit auf marginalisierte Perspektiven.
Wer in diesen Bereichen studiert und lehrt, wird deutlich mehr Auswahl an Inhalten vorfinden, die Diversität selbstverständlich einbinden. Hingegen sind klassische Bereiche wie die Philosophie, Theologie oder viktorianische Literatur traditionell von weißen männlichen Autor*innen dominiert. Das stellt Lehrende vor die Herausforderung, trotz dieser thematischen Beschränkungen Räume für alternative Perspektiven zu schaffen.Ein positiver Ansatz ist es, sich mit Kolleg*innen auszutauschen, die Expertise in diversen Forschungsfeldern haben. Social Media, akademische Netzwerke und interdisziplinäre Zusammenarbeit bieten heute vielfältige Möglichkeiten, um Empfehlungen für Werke von Autor*innen zu erhalten, die jenseits der „westlichen Standard-Biographie“ liegen.
So kommen neue Autor*innen und Denker*innen ins Bewusstsein, die früher kaum Berücksichtigung fanden. Texte wie Ralph Ellisons „Invisible Man“, Jo Waltons „The Just City“ oder Yukio Mishimas „The Sailor Who Fell from Grace with the Sea“ erweitern nicht nur den Horizont, sondern bereichern das Verständnis von Ideenwelten. Inklusive Lehrpläne stellen also kein bloßes Zugeständnis dar, sondern fördern eine inhaltliche Tiefe und Komplexität, die traditionelle Kanons unter Umständen vermissen lassen.Kritisch diskutiert wird immer wieder die Frage, ob ein Fokus auf die gesellschaftlichen Kategorien der Autor*innen wie Hautfarbe, Geschlecht oder Sexualität nicht zu einer Form von Gegen-Diskriminierung führen könnte. Manche argumentieren, dass einzig die Qualität der Ideen entscheidend sein sollte.
Doch in der Realität sind Werke und ihre Anerkennung nie wertfrei. Eine Re-Orientierung bedeutet also nicht, willkürlich Minderheiten einzubauen, sondern absichtlich Räume zu schaffen, die historisch marginalisiert und ausgeschlossen wurden. Auf diese Weise wird eine objektivere, gerechtere Bewertung von Texten ermöglicht.Das Einbeziehen vielfältiger Perspektiven ist auch für Studierende ein Gewinn. Es fördert kritisches Denken, weitet empathische Fähigkeiten aus und bereitet besser auf eine pluralistische Gesellschaft vor.
Reine Kanonische Lehrpläne vermitteln dagegen eher eine Einbahnstraße der Werte und Weltbilder, die den Blick auf die globale Vielfalt verengen.Die praktische Umsetzung inklusiver Lehrpläne erfordert jedoch institutionelle Unterstützung. Zeitliche und personelle Ressourcen müssen bereitgestellt werden, Workshops zur Sensibilisierung angeboten und Anreize für Lehrende geschaffen werden, die diesen Mehraufwand auf sich nehmen. Außerdem müssen Curricula regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden, um aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu reflektieren. Ein alleiniger individueller Einsatz reicht langfristig nicht aus, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken.