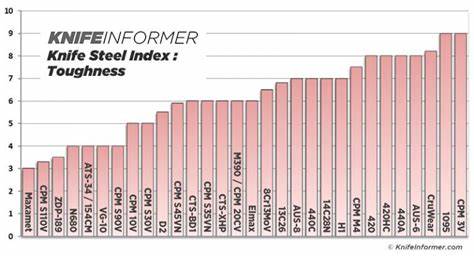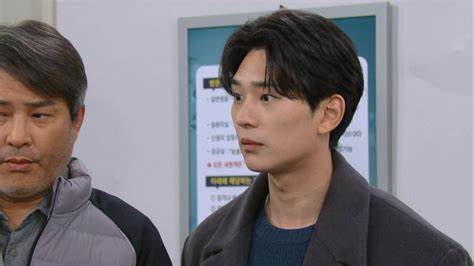Die Verbreitung von Künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz nimmt rasant zu, doch eine kürzlich veröffentlichte Studie von KPMG und der University of Melbourne wirft ein Schlaglicht auf eine besorgniserregende Entwicklung: Mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden weltweit verbergen den Einsatz von KI vor ihren Vorgesetzten. Diese Praxis, die von den Mitarbeitenden teils aus Angst vor negativen Folgen, teils aber auch aus dem Wunsch nach Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz getrieben wird, birgt vielfältige Risiken für Unternehmen, die es zu verstehen und zu adressieren gilt. Die global angelegte Untersuchung befragte knapp 48.000 Personen in 47 Ländern, zwischen November 2024 und Januar 2025, und zeigt eindrucksvoll, wie tief KI in den Arbeitsalltag eingedrungen ist. Über 58 % der Befragten gaben an, bewusst KI-Technologien für ihre Arbeit zu nutzen, wobei etwa ein Drittel der Nutzer dies sogar wöchentlich tut.
Gleichzeitig bestätigte jedoch mehr als die Hälfte der Angestellten, dass sie den Einsatz von KI gegenüber ihren Vorgesetzten nicht offenlegen und oft die von KI generierten Ergebnisse als eigene Arbeit präsentieren. Diese Verheimlichung ist nicht nur Ausdruck einer widersprüchlichen Beziehung zu den neuen Technologien, sondern auch ein Indikator für mangelndes Vertrauen und fehlende klare Richtlinien in Unternehmen. Nach Ansicht der Studienautorin Nicole Gillespie, Professorin für Management und Vertrauen an der University of Melbourne, zeigen die Ergebnisse eine beunruhigende Tendenz zu intransparenter und teilweise unangemessener Nutzung von KI. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Ein Hauptfaktor ist der zunehmende Druck auf die Mitarbeitenden, mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten, um nicht im Wettbewerb zurückzufallen oder sogar den Arbeitsplatz zu riskieren.
Restriktive Unternehmenspolitik bezüglich Genauer KI-Nutzung führt oftmals dazu, dass Mitarbeitende KI-Anwendungen heimlich benutzen, anstatt offen mit Vorgesetzten darüber zu kommunizieren. Gillespie hebt zudem hervor, dass die verführerischen Vorteile von KI dazu führen, dass viele Arbeitnehmer trotz Unternehmensverboten auf diese Tools setzen. Diese Erkenntnis deutet darauf hin, dass der Wunsch nach Produktivitätssteigerung und Effizienz häufig die Angst vor eventuellen Konsequenzen überwiegt. Die Studie zeigt zudem, dass nur 47 % der weltweiten Arbeitnehmerschaft jemals eine gezielte Schulung im Umgang mit KI erhalten haben. Die Folge ist, dass viele Mitarbeitende ohne ausreichendes Verständnis und ohne Anleitung die Technologien nutzen – was das Risiko von Fehlern, Datenschutzverletzungen und Compliance-Problemen erhöht.
Besorgniserregend ist, dass 66 % der Mitarbeitenden ihre KI-generierten Ergebnisse nicht ausreichend auf Richtigkeit überprüfen, während 48 % bereits firmeneigene Informationen in öffentliche KI-Systeme eingepflegt haben. Über die Hälfte berichtete von Fehlern, die durch den Einsatz von KI entstanden sind. Der globale KI-Transformationsexperte von KPMG, Sam Gloede, warnt, dass diese Praktiken nicht nur zu direkten Risiken wie Datenverlusten und Verstößen gegen gesetzliche Vorgaben führen, sondern auch das Vertrauen innerhalb von Unternehmen und gegenüber KI insgesamt untergraben. Vertrauen gilt in der Unternehmenswelt als eine strategische Ressource, die essenziell für nachhaltige Innovation und Wachstum ist. Um dem wachsenden Vertrauensverlust entgegenzuwirken, ist es laut den Experten entscheidend, dass Unternehmen vermehrt in KI-Bildung und transparente Governance-Modelle investieren.
Die Studie illustriert, dass in vielen Unternehmen grundlegendes Wissen über KI und deren Einsatzmöglichkeiten fehlt, was wiederum zu unkontrolliertem und riskantem Gebrauch führt. Ein fundiertes Verständnis der Technik, ethischer Richtlinien und verantwortungsvoller Nutzung müsse integraler Bestandteil der Unternehmenskultur werden. Die Forschenden betonen, dass effektive KI-Schulungen nicht nur Grundlagenwissen vermitteln sollten, sondern auch auf die jeweiligen Arbeitsbereiche zugeschnitten sein müssen. So könnten Mitarbeitende lernen, die Technologie effizient und fehlerfrei einzusetzen, während gleichzeitig Offenheit und Erfahrungsaustausch gefördert werden. Nur in einer Umgebung, die Transparenz, Lernen und kontrolliertes Experimentieren unterstützt, könne KI ihr volles Potenzial entfalten, ohne die Sicherheit und Integrität des Unternehmens zu gefährden.
Bemerkenswert ist der internationale Vergleich der Studie: In Schwellenländern wie Indien, Nigeria und Saudi-Arabien zeigte sich ein deutlich höheres Vertrauen in KI (82 %) verglichen mit etablierten Industrieländern (65 %). Interessanterweise korrelierte dieses höhere Vertrauen mit einem besseren Schulungsangebot und einer intensiveren Auseinandersetzung mit der Technologie. Dies verdeutlicht, wie essenziell Bildung und Aufklärung für den erfolgreichen Einsatz von KI sind – unabhängig von der Wirtschaftskraft eines Landes. Unternehmen stehen mit dem Ergebnis vor der Herausforderung, eine Balance zu finden zwischen dem fördernden und disziplinierenden Umgang mit KI im Arbeitsumfeld. Ein komplettes Verbot von KI-Anwendungen scheint aufgrund des Nutzenpotentials kaum realistisch, erhöht aber die Tendenz zur Heimlichkeit.
Stattdessen bedarf es klarer Kommunikationswege, offener Richtlinien und regelmäßiger Trainings. Nur durch eine Kultur, die offene Dialoge über KI zulässt und transparent mit deren Einsatz umgeht, können Risiken minimiert und Vertrauen langfristig aufgebaut werden. Zusammenfassend zeigt die KPMG-Studie eindrücklich, dass die Diskussion um KI am Arbeitsplatz nicht mehr nur um technische Aspekte gehen darf, sondern vor allem um menschliche Faktoren wie Vertrauen, Ehrlichkeit und Weiterbildung. Unternehmen, die diese Dimensionen vernachlässigen, laufen Gefahr, durch undurchsichtigen KI-Einsatz interne Risiken und Imageverluste zu erleiden. Gleichzeitig bietet sich die Chance, durch gezielte Maßnahmen eine verantwortungsvolle und produktive KI-Nutzung zu fördern, die alle Beteiligten stärkt.
In einer Zeit, in der KI immer mehr Arbeitsprozesse durchdringt, wird die Fähigkeit der Unternehmen, eine vertrauensvolle und transparente KI-Kultur zu etablieren, zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Wer jetzt in Schulungen, klare Leitlinien und offene Kommunikation investiert, profitiert langfristig von einer motivierten Belegschaft und einem nachhaltigen Innovationsumfeld.