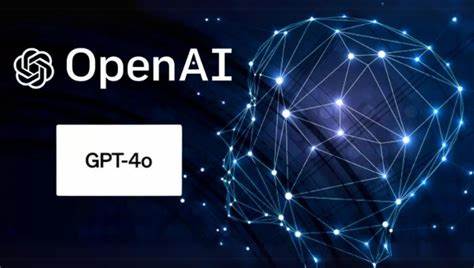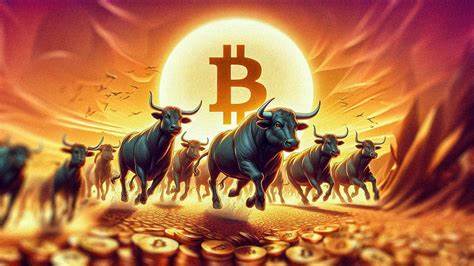Open Source Software (OSS) hat die Art und Weise, wie Software entwickelt, verbreitet und genutzt wird, grundlegend verändert. Seit den ersten Tagen der freien Softwarebewegung bis heute zeichnet sich der Bereich durch stetige Entwicklung und Wandel aus. Die jüngsten Jahre zeigen jedoch, dass Progression nicht linear verläuft – vielmehr gleicht sie einem Tanz aus zwei Schritten vorwärts und einem Schritt zurück. Insbesondere die Veränderungen bei Lizenzmodellen sowie das Verhältnis zwischen kommerziellen Anbietern, Stiftungen und der Open Source Community spielen dabei eine zentrale Rolle. Ein entscheidender Wendepunkt in der Lizenzdiskussion war die Einführung der Server Side Public License (SSPL) durch MongoDB im Jahr 2018.
Bis dahin war MongoDB unter der AGPL (Affero General Public License) lizenziert, einer Lizenz, die über die klassische GPL hinausgeht, indem sie auch Software abdeckt, die über Netzwerke bereitgestellt wird. Die AGPL zielt darauf ab, die sogenannte „Loophole“ zu schließen, bei der Anbieter von Software, die über das Internet gehostet wird, keine Verpflichtung hatten, ihre Modifikationen zu teilen. Trotz dieser erweiterten Schutzfunktion der AGPL herrschte Skepsis und Zurückhaltung bei großen Internetunternehmen. Diese scheuten sich aufgrund der starken Anforderungen vor der Nutzung dieser Lizenz. MongoDB befand die Regeln der AGPL als unzureichend, um den Missbrauch ihres Codes durch Cloud-Dienstleister einzudämmen.
So entstand die SSPL, die in ihrer Reichweite über das reine Programm hinausgreift und auch angrenzende Softwarekomponenten wie Management- oder Automationssoftware einschließt. Aufgrund dieser weitreichenden Forderungen gilt die SSPL als kaum praktikabel für große Cloud-Anbieter und steht im Widerspruch zu mindestens einer der grundlegenden Anforderungen der Open Source Definition, die besagt, dass eine Lizenz nicht andere mitverteilte Software einschränken darf. Der Versuch von MongoDB, die SSPL durch die Open Source Initiative (OSI) anerkennen zu lassen, scheiterte letztlich angesichts der grundsätzlichen Konflikte mit dem Open Source Gedanken und des unklaren, kontroversen Prüfprozesses. So verbleibt die SSPL im Status einer „source available license“, also nur quelloffen, aber nicht als echte Open Source Lizenz anerkannt. Der Trend hin zu strengeren Lizenzen beschränkt sich jedoch nicht nur auf MongoDB.
Auch andere Anbieter wie Elastic und Redis wechselten weg von permissiven Lizenzen wie Apache zu SSPL oder einer Kombination aus SSPL und AGPL. Diese Entwicklung spiegelt den Wunsch kommerzieller Unternehmen wider, ihren Code besser vor Ausbeutung durch große Cloud-Anbieter zu schützen, die mit immens größerer Infrastruktur ganze Dienste bereitstellen und somit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den ursprünglichen Entwicklern erlangen können. Jedoch zeigte sich in den letzten Jahren ein Wandel in der Lizenzstrategie. Elastic und Redis entschieden sich, die SSPL als Lizenzoption zu reduzieren oder ganz abzulegen und stattdessen stärker auf die AGPL als open source-konforme Lizenz zu setzen. Der Grund ist die breite Ablehnung der SSPL in der Community und durch Institutionen wie die OSI, die den Status als Open Source Lizenz verweigern.
Die AGPL scheint als Kompromiss die Balance zu halten: Sie schützt die Autoren in großem Maße, wird aber von der Community und Industrie besser akzeptiert. Diese Rückkehr zur AGPL zeigt, dass Open Source als Ökosystem in ständiger Weiterentwicklung begriffen ist. Unternehmen erkennen, dass langfristiger Erfolg nicht nur durch Anwälte und Lizenztricks gesichert werden kann, sondern durch die Akzeptanz der Gemeinschaft und die Schaffung einer vertrauenswürdigen Basis für Zusammenarbeit und gemeinsame Weiterentwicklung. Dabei ist die AGPL mit ihrem starken Copyleft und der Offenlegungspflicht bei Netzwerkbereitstellung ein mächtiges Werkzeug, ohne die Offenheit, die Open Source auszeichnet, zu opfern. Ein weiterer interessanter Aspekt in diesem Kontext ist die Rolle von Open Source Stiftungen wie der Cloud Native Computing Foundation (CNCF).
Diese Institutionen bieten Projekte wie Kubernetes oder Prometheus eine neutrale Heimat, in der Rechte, Governance und Neutralität garantiert werden sollen. Dennoch ist die Zusammenarbeit zwischen Stiftungen und kommerziellen Anbietern oft komplex und konfliktträchtig. Ein Beispiel ist der Streit zwischen Synadia, den Hauptautoren von NATS, und der CNCF, der im Frühjahr 2025 öffentlich wurde. Die Auseinandersetzung drehte sich um die Drohung von Synadia, die Spende seines Projekts samt Markenrechten zurückzuziehen – ein seltenes, aber brisantes Ereignis in der Welt der Open Source Stiftungen. Dieser Konflikt offenbart tiefe Spannungen und Uneinigkeit innerhalb der Open Source Community.
Viele Beobachter nutzen solche Vorfälle, um Kritik an der Rolle und Effizienz von Stiftungen im Open Source Umfeld zu üben. Dabei wird oft angeführt, dass Stiftungen Schwierigkeiten haben, die unterschiedlichen Interessen von kommerziellen Unternehmen, Einzelentwicklern und der Community in Einklang zu bringen. Die Balance zwischen Offenheit, Neutralität und wirtschaftlichen Interessen ist schwer zu halten und bleibt eine der zentralen Herausforderungen für das gesamte Ökosystem. Wichtig ist, zu verstehen, dass die Übertragung eines Projekts inklusive Markenrechten an eine Stiftung in der Regel als eine bindende, irreversible Entscheidung zu verstehen ist. Ein kommerzielles Unternehmen kann nicht einfach aus einem solchen Arrangement aussteigen, ohne die Grundlagen der Neutralität und des Vertrauens, die Stiftungen bieten, zu untergraben.
Ein Austritt oder Rückzug wirft nicht nur Fragen zur Governance und Verlässlichkeit auf, sondern bedroht das Fundament, auf dem viele Open Source Projekte aufbauen. Während die Lizenzdebatte sich also auf der einen Seite auf die Qualität und Praxisfreiheit von Lizenzmodellen konzentriert, richtet sich der Blick auf der anderen Seite auch auf die Governance-Muster innerhalb der Open Source Welt und die Frage, wie Projekte unabhängig und nachhaltig betrieben werden können. Beide Themen hängen eng miteinander zusammen, denn gute Lizenzmodelle sind nur dann wirksam, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, in denen sie angewandt und durchgesetzt werden. Der Trend, dass immer mehr Projekte von sehr permissiven Lizenzen wie Apache auf restriktivere und zugleich Open Source konforme Lizenzen wie die AGPL umsteigen, zeigt eine Reaktion auf die Herausforderung großer Cloud-Anbieter, die freie Software nutzen, um eigene Dienste zu gestalten, ohne selbst beizutragen. Diese Entwicklung stellt sicher, dass nicht nur der Initialautor von Software geschützt wird, sondern auch eine Rückflussverpflichtung zur Community entsteht.
Gleichzeitig besteht die Befürchtung, dass das Einführen strengerer Lizenzmodelle die Verbreitung und Akzeptanz von Projekten erschweren könnte. Die Balance zwischen Schutz und Offenheit zu finden ist damit essenziell für eine gesunde Open Source Landschaft, die Innovation fördert, ohne den kommerziellen Erfolg zu blockieren. Eine weitere interessante Perspektive sind die technischen und rechtlichen Herausforderungen, die sich aus dem steigenden Wettbewerb bezüglich APIs und Schnittstellen ergeben. Die jüngsten Urteile wie das Google-gegen-Oracle-Urteil legen nahe, dass in Zukunft nicht allein der Quellcode, sondern vielmehr die APIs und Interoperabilität im Mittelpunkt von Wettbewerbsfragen und rechtlichen Streitigkeiten stehen könnten. Diese Verlagerung der Wettbewerbsschwerpunkte wird weitere neue Dynamiken in der OSS-Community und im Lizenzumfeld erzeugen.
Open Source Software steht heute an einem Scheideweg. Die Fortschritte beim Schutz von geistigem Eigentum zeigen, dass die Branche aus Fehlern und Herausforderungen gelernt hat. Zugleich erinnert der jüngste Konflikt um NATS und die Diskussion rund um die Rolle von Stiftungen daran, dass die Gemeinschaft und Governance wichtige Pfeiler sind, um Vertrauen, Nachhaltigkeit und Wachstum zu gewährleisten. Das Bild, das sich daraus ergibt, ist vielschichtig und komplex. Es ist ein Ökosystem, in dem Innovation und Zusammenarbeit trotz auftretender Kontroversen weiter gedeihen.
Das Prinzip der zwei Schritte vorwärts und ein Schritt zurück kennzeichnet diese Entwicklung treffend und zeigt zugleich, dass Rückschritte nicht das Ende, sondern Teil eines längerfristigen Fortschrittsprozesses sind. Für die kommenden Jahre bleibt zu beobachten, wie sich Lizenzmodelle weiterentwickeln und wie Stiftungen ihre Rolle als neutrale Wächter und Förderer der Open Source Kultur ausbauen werden. Die Herausforderungen, die große Cloud-Anbieter und wirtschaftliche Interessen mit sich bringen, erfordern innovative Ansätze sowohl juristischer als auch organisatorischer Natur. Nur durch eine enge Verzahnung von technischer Exzellenz, klaren Lizenzbedingungen und funktionierenden governance-Strukturen lässt sich die Zukunft von Open Source erfolgreich gestalten. Die Open Source Community steht vor der Aufgabe, aus den jüngsten Erfahrungen und Konflikten zu lernen, neue Standards zu setzen und gleichzeitig die Grundwerte von Offenheit, Freiheit und Zusammenarbeit zu bewahren.
Diese Balance macht die Stärke und den Reichtum von OSS aus – und wird auch in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg sein.