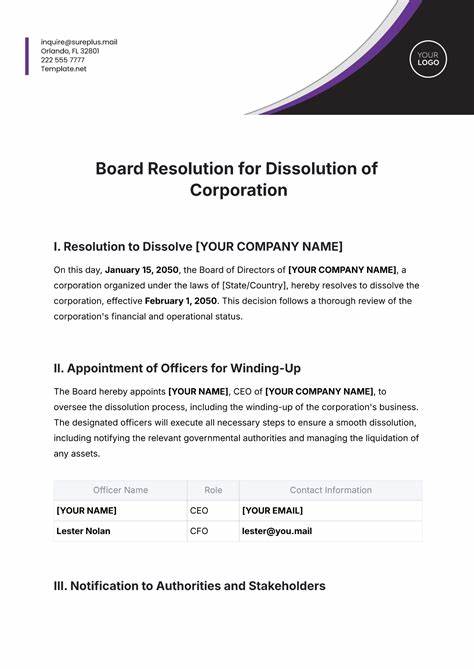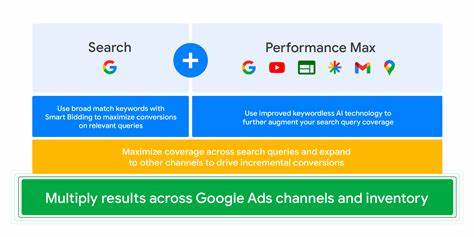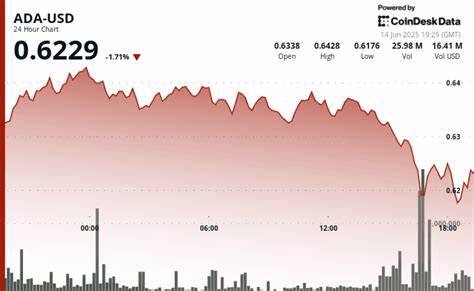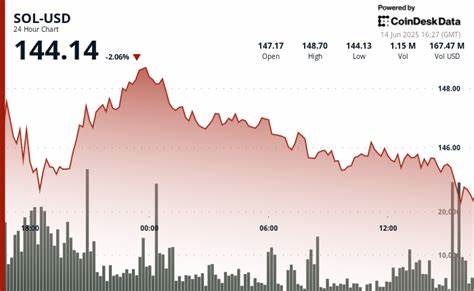Bäume sind seit langem als natürliche Verbündete im Kampf gegen den Klimawandel anerkannt. Sie absorbieren Kohlendioxid (CO₂) aus der Atmosphäre, speichern Kohlenstoff in ihrem Holz und ihren Böden und tragen gleichzeitig zur Regulierung des lokalen und globalen Klimas bei. Aufforstung und Wiederaufforstung sind daher zentrale Maßnahmen, die in globalen Klimaschutzplänen präferiert werden. Doch die Wirkung von Baumpflanzungen auf das Klima ist komplex und wird nicht nur von der Kohlenstoffbindung bestimmt. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass atmosphärische Chemie eine entscheidende Rolle dabei spielt, wie effektiv Baumpflanzungen tatsächlich das Klima beeinflussen können.
Die Bedeutung atmosphärischer Prozesse wurde in der Klima- und Forstwirtschaft bisher häufig unterschätzt. Dabei umfasst atmosphärische Chemie die Wechselwirkungen von pflanzlichen Emissionen, Aerosolen, Wolkenbildung und Kurzlebigen Klimafaktoren (SLCFs) wie Ozon und Methan, die alle tiefgreifend auf den Strahlungshaushalt der Erde wirken. Neue Klimamodelle, die chemisch-interaktive Prozesse berücksichtigen, zeigen, dass der Effekt dieser Prozesse die Klimawirkung von Aufforstungen erheblich verändern kann. Klassische Konzepte konzentrierten sich auf die biogeochemischen Effekte von Bäumen, also den Kohlenstoffkreislauf und dessen direkten Einfluss auf die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre. Die Regeneration von Wäldern, vor allem in tropischen Regionen, wurde als effektives Mittel zur Kohlenstoffbindung eingestuft.
Allerdings begrenzten biogeophysikalische Effekte wie die Abnahme der Oberflächenalbedo (Reflexion des Sonnenlichts) in borealen und gemäßigten Regionen den Klimanutzen. Durch die dunklere Oberfläche absorbiert die Erde mehr Sonnenenergie, was zu einer regionalen Erwärmung führt. Diese Wirkung konnte die durch CO₂-Sequestrierung erreichte Abkühlung in manchen Gebieten abschwächen oder sogar überschreiten. Hier setzt die Rolle der atmosphärischen Chemie an. Bäume emittieren sogenannte biogene flüchtige organische Verbindungen (BVOCs) wie Isopren und Monoterpene, welche in komplexen chemischen Reaktionen Aerosole bilden, insbesondere sekundäre organische Aerosole (SOA).
Diese Aerosole können das Sonnenlicht streuen und Wolkenkondensationskeime bilden, was zu einer höheren Wolkendichte und damit zu einer geringeren Strahlungsabsorption führt. Die Folge sind kühlende Effekte, die den klimawirksamen Einfluss der dunkleren Waldflächen relativieren oder gar überkompensieren können. Eine aktuelle Untersuchung mit dem Community Earth System Model (CESM2) hat diesen Effekt simuliert, indem zwei Modellreihen durchgeführt wurden: eine mit und eine ohne interaktive atmosphärische Chemie. Der Unterschied ermöglichte es, den Einfluss der an atmosphärischen Prozessen beteiligten chemischen Stoffe realistisch zu bestimmen. Unter dem Szenario einer großflächigen Baumpflanzung wurde klar, dass die Berücksichtigung der Atmosphärenchemie die erwartete Erwärmung durch reduzierte Albedo im Vergleich zu einem Modell ohne diese Effekte deutlich abmildert.
Besonders in der südlichen Hemisphäre zeigte sich eine bemerkenswerte Wirkung. Dort führte die verstärkte Emission von BVOCs durch tropische Baumpflanzungen zu einem signifikanten Anstieg der SOA-Konzentrationen. Diese wiederum erhöhten die Wolkenbildung und trugen durch erhöhte Reflexion des Sonnenlichts zu einer kühlenden Wirkung bei, die regional sogar zu einer Abkühlung führte, obwohl gleichzeitig durch die Baumpflanzung die Oberflächenalbedo sank. Dieser Effekt wurde vor allem durch Aerosol-Wolken-Wechselwirkungen und deren indirekte klimatische Effekte bestimmt. Auch die Methankonzentration reagierte indirekt auf die veränderten atmosphärischen Bedingungen.
Die höheren BVOC-Emissionen reduzierten den Hydroxylradikal-Gehalt (OH) in der Atmosphäre, der normalerweise Methan abbaut. Dadurch verlängerte sich die Lebensdauer von Methan, einem starken Treibhausgas, und verstärkte in geringerem Umfang die Erwärmung. Dennoch konnte das kühlende Wirken der Aerosole und Wolkenbildung diesen Effekt überwiegen, sodass insgesamt eine stärkere Klimaminderung durch die Einbeziehung der atmosphärischen Chemie beobachtet wurde. Im Kontext der Feueraktivität zeigte das Modell ebenfalls wichtige Erkenntnisse. In tropischen Regionen, in denen Baumpflanzungen hauptsächlich Grasflächen ersetzten, nahmen Feueraktivität und Kohlenstoffemissionen ab.
Dies ist auf die Feuchtigkeitszunahme zurückzuführen, die durch erhöhte Evapotranspiration der neu gepflanzten Bäume bewirkt wurde, was die Entflammbarkeit von Vegetation verringerte. Im Gegensatz dazu stieg in einigen extratropischen Zonen trotz Baumpflanzung die Feuerbrennfläche und die Emissionen an, was die Wirksamkeit der Kohlenstoffbindung dort abmindert. Die Berücksichtigung atmosphärischer Chemie trug jedoch zu einer Abschwächung dieser extratropischen Feuerzunahme bei. Des Weiteren stärkte die atmosphärische Chemie die Effizienz der Kohlenstoffbindung in Baumarealen, insbesondere im nördlichen Hemisphäre durch erhöhte Stickstoffdeposition, die das Pflanzenwachstum fördert. Dies ist von großer Bedeutung, da der Land-Kohlenstoffspeicher als kritischer Faktor in Klimamodellen gilt.
Die Studie zeigte, dass die Menge des durch Baumpflanzungen gespeicherten Kohlenstoffs durch atmosphärische Wechselwirkungen um mehrere Prozent steigen kann. Zusammengefasst deutet die Forschung darauf hin, dass erhöhte Emissionen biogener organischer Stoffe durch Baumpflanzungen eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Klimawirkung spielen. Die atmosphärische Chemie führt zu einer Verstärkung der kühlenden Aerosol- und Wolkeneffekte, die den Temperaturanstieg aufgrund von weniger reflektierender Erdoberfläche dämpfen. Für die Klimapolitik hat dies direkte Konsequenzen: Aufforstungsprogramme könnten wirkungsvoller sein als bisher angenommen, wenn atmosphärische Chemieeffekte berücksichtigt werden. Die globale Verteilung der Baumpflanzungen ist dabei entscheidend.
Tropische Aufforstungen haben aufgrund des hohen BVOC-Ausstoßes und der dort vorherrschenden klimatischen Bedingungen einen größeren kühlenden Effekt als bisher angenommen. Aufforstungsprojekte in der südlichen Hemisphäre, etwa in Südamerika und Afrika, bieten somit erhebliche Klimavorteile, einschließlich einer Reduktion der Feueraktivität und erhöhter Wolkenbildung. Dennoch bleiben Herausforderungen. Die Simulationen basieren auf einem einzelnen Klimamodell und setzen eine sofortige großflächige Veränderung der Landnutzung voraus. In der Realität erfolgt die Aufforstung schrittweise, nahezu nie so abrupt, was das Zusammenspiel von Biogeochemie, Biogeophysik und atmosphärischer Chemie dynamisch beeinflusst.
Zudem sind lokale Umweltbedingungen, Landwirtschaft, Biodiversität und sozioökonomische Faktoren wichtige Einflüsse auf den Erfolg von Baumpflanzungen. Für zukünftige Forschungen ist es daher essenziell, vielfältige wissenschaftliche Ansätze und Modelle zu kombinieren. Bewertet werden sollte nicht nur die Kohlenstoffbindung, sondern auch atmosphärische Wechselwirkungen, die regionale Klimaeffekte und Luftqualität beeinflussen. Insbesondere die Auswirkungen auf Luftschadstoffe wie Ozon und Feinstaub müssen berücksichtigt werden, da erhöhte BVOC-Emissionen regional die Luftqualität verschlechtern können. Insgesamt eröffnen die Einflüsse der atmosphärischen Chemie neue Perspektiven für Baumrestaurationsstrategien und Klimaschutzpolitiken.
Sie unterstreichen die hohe Komplexität der natürlichen Systeme und betonen die Bedeutung einer integrierten Betrachtung von Biophysik, Biogeochemie und atmosphärischer Chemie. Der positiv verstärkte Beitrag von Baumpflanzungen durch atmosphärische Prozesse erhöht die Zuversicht, dass natürliche Klimaschutzmaßnahmen eine bedeutende Rolle in der Verlangsamung der globalen Erwärmung einnehmen können. Kurz gesagt ist der Klimavorteil großer Aufforstungsprojekte größer als bisher angenommen, wenn die komplexen Wechselwirkungen der Atmosphäre, insbesondere die Bildung von bioorganischen Aerosolen und deren Einfluss auf Cloud-Solarstrahlungsprozesse, mit einbezogen werden. Diese Erkenntnis sollte Einfluss auf künftige Klimamodelle, politische Planungen und Umsetzungsstrategien zur CO₂-Reduktion haben, um das true Potenzial nachhaltiger Waldschutz- und Aufforstungsprogramme voll auszuschöpfen.