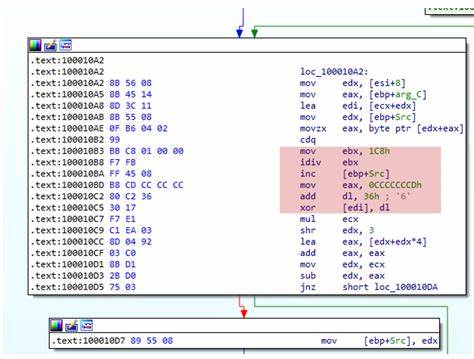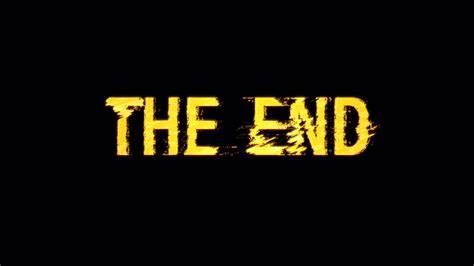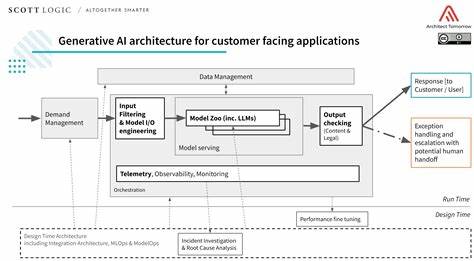In den letzten Jahren ist ein besorgniserregender Trend in der wissenschaftlichen Gemeinschaft erkennbar: Immer mehr wissenschaftliche Konferenzen verlassen die Vereinigten Staaten aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich Einwanderungs- und Visabestimmungen. Forschende aus aller Welt berichten von zunehmenden Schwierigkeiten und Ängsten bei der Einreise in die USA, was viele Veranstalter zwingt, nationale und internationale Tagungen zu verschieben, abzusagen oder an andere Orte zu verlagern. Dieses Phänomen hat tiefgreifende Auswirkungen nicht nur auf die USA als führenden Wissenschaftsstandort, sondern auch auf die globale Forschungskultur insgesamt. Die USA waren traditionell einer der attraktivsten Standorte für wissenschaftliche Kongresse. Die exzellente Infrastruktur, renommierte Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie die breite Palette an Themenregionen machten das Land zu einem flächendeckenden Zentrum des internationalen Wissensaustauschs.
Viele Forschende aus aller Welt nutzten die Gelegenheit, wichtige Kontakte zu knüpfen, Kooperationen zu initiieren und ihre Forschungsergebnisse vor einem globalen Publikum zu präsentieren. Doch die aktuellen politischen Entwicklungen und verstärkte Kontrollen an den US-Grenzen haben diese klassische Rolle stark beeinträchtigt. Besonders ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berichten von einem Gefühl der Unsicherheit und Angst. Berichte über langwierige Visa-Prozesse, strenge Befragungen bei der Einreise und teils willkürlich erscheinende Ablehnungen haben eine Atmosphäre der Unsicherheit geschaffen. Viele Forschende, besonders aus Ländern, die als besonders risikobehaftet gelten, möchten eine unangenehme Erfahrung bei der Einreise vermeiden und entscheiden sich deshalb, an Konferenzen in sicheren Drittstaaten teilzunehmen.
Selbst renommierte Veranstaltungen sehen sich mit einem massiven Rückgang der internationalen Teilnehmerzahlen konfrontiert. In einigen Fällen führten die Einreiseprobleme sogar zur völligen Absage der Konferenzen oder der Verlegung ins Ausland. Die Folgen für die US-Wissenschaft sind vielfältig. Zunächst einmal verliert das Land zunehmend seine Rolle als Anziehungspunkt für weltweite Talente und Ideen. Der persönliche Austausch, der für viele Innovationen und Kooperationen essenziell ist, wird durch weniger internationale Präsenz schwächer.
Dies kann langfristig zu einem Innovationsverlust führen und die Wettbewerbsfähigkeit der US-Forschung beeinträchtigen. Zudem entsteht ein Imageproblem: Die USA könnten als unfreundlich oder gar abschreckend für internationale Wissenschaftler wahrgenommen werden, was mittel- und langfristig zu einem Brain Drain führt. Auf der anderen Seite profitieren Länder, die vermehrt als alternativer Ort für wissenschaftliche Tagungen auftreten, von diesem Wandel. Städte in Europa, Asien oder Kanada sind zunehmend Gastgeber großer Kongresse, was sowohl deren Status als Wissenschaftszentren stärkt als auch wirtschaftliche Vorteile bringt. Diese Verlagerung führt zu einer Diversifizierung der Forschungslandschaft und macht den internationalen Wissenschaftsaustausch noch globaler, was zwar grundsätzlich positiv ist, jedoch bedeutet dies auch einen Wettbewerbsdruck für die USA.
Die Ursprung der Einwanderungssorgen liegen in einer strengeren Einwanderungspolitik und einem umfassenderen Grenzmanagement, das vor allem in den letzten Jahren verschärft wurde. Die US-Behörden begründen diese Maßnahmen mit Sicherheitsbedenken, insbesondere in einer geopolitisch volatilen Welt. Im täglichen Ablauf bedeutet dies jedoch, dass besonders Forscher aus bestimmten Ländern, oder auch solche mit speziellen Profilen wie etwa sensiblen Forschungsgebieten, verstärkt kontrolliert werden. Für viele Wissenschaftler ist die Unsicherheit, ob sie überhaupt rechtzeitig zum Kongress oder zur Konferenz einreisen können, zu groß geworden. Ein weiteres Problem bildet die fehlende Transparenz und Vorhersehbarkeit bei den Visa- und Einreiseentscheidungen.
Das erschwert die Planung erheblich und führt dazu, dass viele Veranstalter vorsichtshalber auf weniger riskante Veranstaltungsorte ausweichen. Hinzu kommen administrativer Aufwand und Kostensteigerungen für die Teilnehmer, welche die Attraktivität wissenschaftlicher Kongresse in den USA weiter mindern. Die Corona-Pandemie hat diesen Wandel zusätzlich beschleunigt. Die digitalen Alternativen und Hybridveranstaltungen haben gezeigt, dass der Austausch auch virtuell möglich ist. Doch kein digitales Format kann die persönliche Vernetzung und die spontane Zusammenarbeit vollständig ersetzen.
Angesichts der Risiken und Unsicherheiten der Präsenzveranstaltungen in den USA steigt die Akzeptanz und Nutzung solcher Formate, was wiederum die Attraktivität physischer Tagungen in den Vereinigten Staaten weiter schmälert. Die US-Wissenschaftslandschaft steht damit an einem Scheideweg. Um ihre Vorreiterrolle zu behalten, müsste sie Maßnahmen ergreifen, die Einreiseprozesse beschleunigen und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen sicheren und unkomplizierten Zugang ermöglichen. Dies würde nicht nur den Wissenschaftlerverkehr erleichtern, sondern auch ein positives Signal an die internationale Forschergemeinde senden. Einige Programme und Ausnahmen für hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler existieren zwar bereits, doch sie reichen offensichtlich nicht aus, um Ängste und Unsicherheiten zu beseitigen.
Ein weiterer Aspekt ist die Zusammenarbeit von Akademien, wissenschaftlichen Gesellschaften und politischen Akteuren, um auf diese Herausforderungen zu reagieren. Nur ein koordinierter Ansatz kann sicherstellen, dass das Forschungsumfeld in den USA attraktiv und zugänglich bleibt. Innovative Lösungen könnten etwa spezialisierte Visa für Konferenzteilnehmer oder erleichterte Einreiseverfahren während großer Veranstaltungen umfassen. Zugleich zeigt die aktuelle Entwicklung, wie wichtig eine globale Perspektive im Wissenschaftssystem ist. Die Verlagerung von Konferenzen in andere Länder könnte langfristig eine breitere internationale Zusammenarbeit fördern und neue Impulse setzen.
Es bleibt jedoch zu hoffen, dass dadurch keine ungewollte Fragmentierung des globalen Wissenschaftsaustauschs eintritt und dass gemeinsame Standards und offene Zugänge erhalten bleiben. Insgesamt ist die Situation komplex und hat vielschichtige Ursachen und Folgen. Wissenschaftliche Konferenzen spielen eine zentrale Rolle für die Verbreitung von Wissen, die Vernetzung von Experten und die Entwicklung neuer Forschungsideen. Wenn die USA zunehmend als schwieriger Zugangspunkt wahrgenommen werden, sind neben den beteiligten Forschenden auch das gesamte Innovationssystem und letztlich gesellschaftliche Fortschritte betroffen. Der Umgang mit diesen Herausforderungen erfordert politische Sensibilität, einen offenen Dialog mit der Wissenschaftscommunity und pragmatische Lösungen, die sowohl Sicherheitsanliegen berücksichtigen als auch die Offenheit und Internationalität der Forschung gewährleisten.
Nur so kann die USA ihre Position als globaler Wissenschaftsstandort langfristig sichern, der nicht nur durch seine Fachexzellenz, sondern auch durch seine weltoffene Haltung überzeugt.