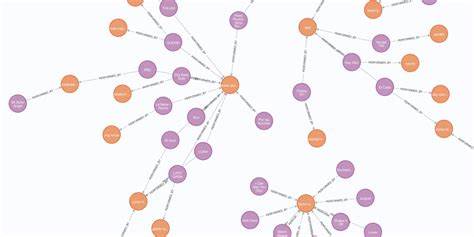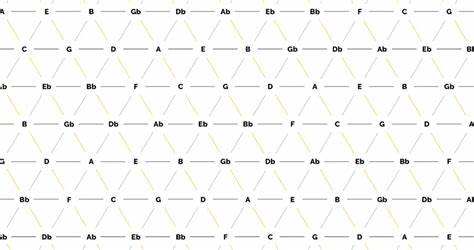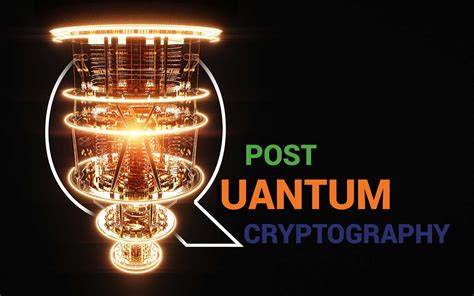Die Elektromobilität befindet sich in einem ständigen Wandel, der nicht nur die Art und Weise verändert, wie wir Fahrzeuge mit Energie versorgen, sondern auch, wie Fahrzeuge Energie zurückspeisen können. Ein Meilenstein in dieser Entwicklung ist die Möglichkeit, Strom aus dem Combined Charging System, kurz CCS-Anschluss, zu ziehen. Dies öffnet neue Türen für Anwendungen wie Vehicle-to-Home (V2H), Vehicle-to-Grid (V2G) und generell bidirektionales Laden. Doch welche technischen Hintergründe verbergen sich hinter diesem Thema, wie funktioniert es aktuell und welche Herausforderungen müssen überwunden werden? Das Combined Charging System, allgemein bekannt als CCS, ist der dominierende Standard für die Schnellladetechnologie von Elektrofahrzeugen in Europa und vielen weiteren Märkten. Ursprünglich konzipiert als ein einseitiges System, bei dem Strom nur in das Fahrzeug fließt, fehlten lange Zeit die Mechanismen, um Energie aus dem Fahrzeug zurück in externe Systeme oder Haushalte zu speisen.
Im Gegensatz dazu bietet der ältere CHAdeMO-Standard, der vor allem in asiatischen Fahrzeugen verbreitet ist, von Beginn an Unterstützung für umgekehrtes Laden oder sogenannte inverse Ladung. Die Frage, wie man Energie über einen CCS-Anschluss herausziehen kann, ist für Besitzer von Elektrofahrzeugen, Energieversorger und Entwickler von Ladeinfrastruktur höchst relevant. Sie eröffnet den Blick auf Energieflüsse, die weit über das einfache Nachladen hinausgehen und das Elektrofahrzeug zum aktiven Teil eines intelligenten Energiesystems machen. Ein entscheidender Aspekt beim Betrieb des CCS-Ports zur Rückspeisung ist die Steuerung der Kontaktoren im Fahrzeug. Kontaktoren sind robuste elektrische Schalter, die den Hochvolt-Stromkreis schließen und so den Energiefluss ermöglichen.
Bei klassischen Ladevorgängen schließt das Fahrzeug diese Kontaktoren, sobald es eine sichere Ladeverbindung erkennt. Für das Herausziehen von Energie muss das Fahrzeugkontaktorsystem jedoch beispielsweise auch vom Ladegerät angesteuert werden, um Strom an den Verbraucher oder das Netz zurückzuliefern. Praktische Tests mit Modellen wie dem Hyundai Ioniq (Baujahr etwa 2018) haben gezeigt, dass die Kontaktoren unter bestimmten Bedingungen geschlossen bleiben und somit Spannung an den CCS-Anschluss gelegt wird. Um dieses Verhalten zu erreichen, ist allerdings eine besondere Form der Kommunikationssimulation zwischen Fahrzeug und Ladestation notwendig. Das sogenannte „Simulierte Precharging“ ist ein Verfahren, bei dem die Ladestation dem Fahrzeug vorgaukelt, dass die Vorladung der Batterie (Precharging) erfolgreich war, ohne tatsächlich Spannung an die DC-Pins anzulegen.
Mittels dieser Technik blieb beim Ioniq der Kontaktor bis zu zehn Minuten geschlossen, was ausreichend erlaubt, einige Verbraucher anzuschließen, beispielsweise Lichtquellen mit einer Leistung von 50 Watt. Das Konzept beruht darauf, dass die Ladestation in der Kommunikationsphase (via PLC – Power Line Communication) die vom Fahrzeug geforderten Spannungswerte mitteilt und festlegt, obwohl keine tatsächliche Stromversorgung erfolgt. Für die Firmware- oder Softwareseite wurde beispielsweise das Open-Source-Projekt pyPLC entwickelt, das diese Kommunikation nachahmt und so das Verhalten der Ladestation simuliert, um den bidirektionalen Stromfluss zu ermöglichen. Während die zehn Minuten Haltezeit für einige Anwendungsszenarien ausreichend sein können, ist dies im realen Einsatzbereich zu kurz, da der Energiefluss länger stabil und unbegrenzt möglich sein sollte. Zwischenzeitlich wurden weiterführende Tests mit anderen Fahrzeugen durchgeführt, darunter Modelle wie der MG4, Tesla Model Y und BYD Atto3.
Hier zeigen sich Unterschiede im Verhalten der Fahrzeuge bezüglich der Dauer, wie lange die Kontaktoren geschlossen bleiben und wann einzelne Modelle Sitzungen unmittelbar abbrechen. Während der Hyundai Ioniq noch eine gewisse Toleranz für die simulierte Precharge-Kommunikation besitzt, reagieren beispielsweise Tesla und BYD etwas sensibler auf fehlende echte Spannung an den DC-Pins. Bei letzteren wird die Sitzung schnell unterbrochen oder sogar eine Fehlermeldung generiert, wenn die vom Fahrzeug gemessene Spannung nicht mit der in der Kommunikation angegebenen übereinstimmt. Die Folge sind sogenannte SessionStop-Requests, die die bidirektionale Ladung quasi verhindern. Der MG4 zeigt sich wiederum robust gegenüber diesen Schnelligkeitsprüfungen und konnte bis zu zwei Stunden ohne Unterbrechung Energie an Verbraucher abgeben.
Bei Belastung durch Lasten zwischen 120 und 5000 Watt berichtete das Fahrzeug über keinen kritischen Fehler. Dies zeigt, dass Fahrzeuge mit CCS-Port technisch in der Lage sind, sich als dezentrale Energiespeicher zu bedienen und Strom zurückzugeben. Allerdings ist diese Funktion im Hersteller-Standard noch nicht offiziell vorgesehen und bedarf weiterer technischer Anpassungen und möglicherweise regulatorischer Freigaben. Ein zentrales Problem ist heute noch die Zeitüberschreitung, also das Timeout, bei dem das Fahrzeug nach einer gewissen Wartezeit die Kontaktoren öffnet und die Sitzung beendet. Dieses Timeout variiert je nach Hersteller und Modell.
So dauert es bei VW ID.4 oft nur eine Minute, bei BMW iX4 etwa fünf Minuten, bis die Kontaktoren aus Sicherheits- und Batterie-Schutzgründen geöffnet werden. Praktische Versuche, dieses Timeout zu resetten, indem man eine geringe Stromstärke, beispielsweise 1 bis 2 Ampere, in der Kommunikation meldet, führten meist nicht zum gewünschten Erfolg. Die Fahrzeuge erkennen diese Maßnahme und beenden trotzdem relativ schnell die Sitzung. Einige Entwickler und Forscher versuchen, das durch gezielte Kommunikation und technische Tricks zu umgehen.
Beispielsweise könnte eine externe Schaltung, wie eine aufladbare Kapazität oder eine spezielle elektronische Last, zeitweise kleine „Ladungsimpulse“ an das Fahrzeug senden, die das Timeout zurücksetzen oder verzögern. Ob und wie gut solche Methoden in der Praxis funktionieren, ist noch Gegenstand laufender Forschung. Die ISO 15118 Norm, auf der der CCS-Standard in Bezug auf Kommunikation basiert, sieht in ihren zukünftigen Versionen ausdrücklich bidirektionales Laden vor. Das heißt, dass Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur standardisiert überladen und entladen kommunizieren können, was dem Ziel einer intelligent vernetzten Energiewelt entspricht. Einige Fahrzeuge unterstützen bereits Teilfunktionen aus diesem Standard, und es entstehen Projekte, offene Softwarelösungen und Hardware, die diesen Weg bahnen.
Open-Source-Projekte wie pyPLC oder OpenV2G bieten bereits innovative Softwarelösungen, um Kommunikationsprotokolle zu emulieren, zu analysieren und bidirektionales Laden zu ermöglichen. In Foren und Communitys tauschen sich Entwickler, Bastler und Forscher aus, um Erkenntnisse zu sammeln, Fehlerquellen zu beheben und die dafür erforderlichen technischen Voraussetzungen zu schaffen. Nicht zuletzt spielt die Ladeelektronik, also die sogenannten EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) eine zentrale Rolle. Um die Kommunikation so zu steuern, dass das Fahrzeug zum Ego-Netzwerk Partner wird und Energie abgibt, sind spezielle EVSE-Geräte notwendig, die sowohl die elektrische Anbindung als auch die Kommunikation detailgetreu simulieren oder steuern können. Viele dieser Geräte basieren auf kleine Computer, wie Raspberry Pi oder ähnliche Embedded-Systeme, die mit entsprechenden Kommunikationsmodulen ausgestattet sind.
Praktisch werden Elektrofahrzeuge damit zu mobilen Energiespeichern, die nicht mehr nur als Verbrauchseinheiten fungieren, sondern aktiv Energie in das Heimnetz, Geschäftsnetz oder das öffentliche Stromnetz zurückgeben können. Dieses Potenzial eröffnet neue Geschäftsmodelle, wie die temporäre Nutzung von Fahrzeugbatterien zur Netzstabilisierung, Abdeckung von Lastspitzen oder zur Notstromversorgung bei Stromausfällen. Die Integration der bidirektionalen Nutzung von CCS-Anschlüssen stellt allerdings auch Herausforderungen an die Sicherheit. Sichere Trennung von Hochvolt und Niedervolt, zuverlässiger Schutz gegen Rückströme, sorgfältige Steuerung der kontaktorengesteuerten Energieflusskanäle und umfassende Kommunikationsprotokolle sind Grundvoraussetzungen, damit die Rückspeisung nicht zu Schäden an Fahrzeug oder Infrastruktur führt. Trotz dieser Herausforderungen ist die Technologie auf einem starken Wachstumskurs.
Immer mehr Automobilhersteller und Ladeinfrastruktur Anlagen setzen auf die Weiterentwicklung des CCS-Standards. Außerdem zeigen Pilotprojekte auf der ganzen Welt, wie Vehicle-to-Grid und Vehicle-to-Home Leistungen in der Praxis funktionieren können und zum Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ziehen von Energie aus dem CCS-Anschluss ein vielversprechendes Feld mit großem Potenzial ist. Die Technologie steht noch am Anfang, wird aber von einer starken Community, innovativen Softwareprojekten und einer wachsendenden Anzahl unterstützter Fahrzeugmodelle vorangetrieben. Die nächsten Jahre dürften entscheidende Entwicklungen und Standardisierungen bringen, die Elektrofahrzeuge nicht nur als Transportmittel, sondern als intelligente Energiespeicher und -lieferanten etablieren werden.
Wer heute bereits experimentiert, kann durch das Zusammenspiel von Kommunikationstechnik, Leistungsflussregelung und eigener Ladeelektronik wertvolle Erfahrungen sammeln. Diese helfen nicht nur beim Verständnis der Technologie, sondern liefern auch wichtige Impulse für zukünftige Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität und der Energiewende.