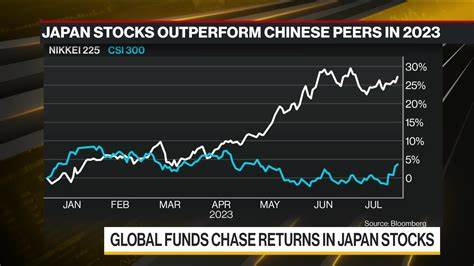Orang-Utans sind für ihre Intelligenz und ihre bemerkenswerten kognitiven Fähigkeiten bekannt, die sie in vielfältigen Situationen einsetzen, etwa bei der Nahrungssuche, beim Nestbau oder im Umgang mit Werkzeugen. Dabei spielt die explorative Objektmanipulation eine entscheidende Rolle, da sie nicht nur die Entdeckung ihrer Umwelt ermöglicht, sondern auch das Lernen und die kognitive Entwicklung fördert. Ein aktueller Forschungsansatz untersucht, wie sich das Verhalten von Orang-Utans in freier Wildbahn von dem zoo-gehaltener Tiere unterscheidet, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise, wie sie Objekte erkunden und manipulieren. Diese Untersuchung liefert aufschlussreiche Erkenntnisse über die Einflüsse der Umgebung auf kognitive Prozesse und Verhaltensweisen. Exploratives Verhalten oder Exploratory Object Manipulation (EOM) beschreibt das bewusste und zielgerichtete Erkunden von Objekten durch Berührung, Manipulation oder visuelle Inspektion.
Bei Orang-Utans umfasst dies oft nicht repetitive und längere Aktivitäten, bei denen sie versuchen, physikalische Eigenschaften von Gegenständen zu verstehen oder sie für bestimmte Zwecke einzusetzen. Dieses Verhalten stimuliert das Lernen und die Fähigkeit, Probleme zu lösen, und ist folglich ein bedeutender Indikator für kognitive Leistungsfähigkeit. Untersuchungen zeigen, dass Orang-Utans in Zoos tendenziell häufiger und vielfältiger Objekte erkunden als ihre wildlebenden Artgenossen. Während Wildorang-Utans vor allem in der frühen Entwicklungsphase rund um das Kleinkindalter einen Höhepunkt in ihrem explorativen Verhalten zeigen und danach eine Abnahme erfahren, fehlt eine solche ausgeprägte Spitze bei zoo-gehaltenen Individuen. Stattdessen zeigen diese eine gleichbleibend höhere Frequenz des Erkundungsverhaltens über das Jugendalter hinaus bis ins Erwachsenenalter.
Diese Beobachtung lässt sich unter anderem auf die unterschiedlichen Umweltbedingungen zurückführen: Im Zoo haben Orang-Utans im Vergleich zur Wildnis deutlich mehr freie Zeit, da die Nahrungsaufnahme geregelt erfolgt und weniger Energie für die Nahrungssuche oder die Schutzsuche vor Fressfeinden aufgewendet werden muss. Darüber hinaus profitieren Zoo-Orang-Utans von einer größeren Vielfalt an verfügbaren Objekten und speziell gestalteten Umgebungen. Zeitgemäße Zoos stellen vielfältige und oft auch computergestützte Enrichment-Objekte zur Verfügung, die unterschiedliche Materialien, Formen, Farben und Texturen aufweisen. Solche Objekte fördern eine breitere Palette von explorativen Handlungen und ermöglichen es den Tieren, verschiedene Manipulationstechniken zu erforschen und zu kombinieren – beispielsweise die Nutzung mehrerer Objekte gleichzeitig oder den gezielten Einsatz von Werkzeugen. Diese komplexeren Manipulationen sind mit einer stärkeren kognitiven Herausforderung verbunden und können somit die kognitive Entwicklung intensivieren.
Ein besonderer Unterschied zwischen den beiden Gruppen betrifft auch die Vielfalt der eingesetzten Körperteile bei der Objektmanipulation. Wildlebende Orang-Utans zeigen meist eine Ausprägung, bei der die Nutzung verschiedener Körperpartien zur Exploration im Alter von vier bis acht Jahren ihren Höhepunkt erreicht, während zoo-gehaltene Tiere bis zu einem Alter von etwa sechzehn Jahren verschiedene Körperteile intensiver und vielfältiger einsetzen. Die Variabilität der verwendeten Körperteile wird dabei als ein Indikator für die Komplexität und Flexibilität der explorativen Handlung betrachtet und kann mit der Entwicklung feinmotorischer Fähigkeiten in Verbindung gebracht werden. Interessanterweise zeigen beide Gruppen ähnliche Zeitpunkte, zu denen bestimmte explorative Verhaltensweisen erstmals auftreten. Dies deutet darauf hin, dass die zeitliche Abfolge der kognitiven Entwicklung und manuellen Fertigkeiten bei Orang-Utans evolutionär verankert und weitgehend unabhängig von den Umweltbedingungen ist.
Dennoch besitzen Zoo-Orang-Utans eine größere Bandbreite an explorativen Verhaltensweisen im Laufe ihres Lebens, was vermutlich mit den vielfältigeren Stimuli und den Bedingungen im Zoo zu erklären ist. Die Ergebnisse der Studien liefern wertvolle Hinweise auf die sogenannte „Haltungseinfluss“ oder „Captivity Bias“, bei der sich kognitive Fähigkeiten und Verhalten von Tieren in Gefangenschaft von denen ihrer wildlebenden Artgenossen unterscheiden. Dieser Bias hat wichtige Implikationen für die Interpretation von kognitiven Tests, bei denen vor allem zoo-gehaltene Tiere für Rückschlüsse auf die evolutionären Wurzeln menschlicher Intelligenz herangezogen werden. Die oft bessere Leistung von Zoo-Orang-Utans in Problemlöseaufgaben kann somit nicht allein auf ihre angeborenen Fähigkeiten zurückgeführt werden, sondern wird durch die besonderen Umweltbedingungen und den vielfältigen Erkundungsmöglichkeiten gestärkt. Nicht nur für die wissenschaftliche Forschung, sondern auch für das Tierwohl in zoologischen Einrichtungen sind diese Erkenntnisse von großer Bedeutung.
Die Förderung von explorativem Verhalten und die Bereitstellung eines abwechslungsreichen, stimulierenden Umfelds tragen maßgeblich zur geistigen Gesundheit der Tiere bei. Durch die Verbesserung der kognitiven Umgebung können Stress reduziert, Langeweile vermieden und das natürliche Verhaltensrepertoire gestärkt werden. Gleichzeitig zeigt sich die enge Verknüpfung zwischen körperlicher Aktivität, kognitiver Stimulation und sozialer Interaktion bei Menschenaffen. Auch im Kontext der Erhaltung gefährdeter Arten wie der Orang-Utans ist die Förderung und Erhaltung kognitiver Fähigkeiten durch geeignete Umweltbedingungen geschätzt. Bei Rehabilitationsprogrammen und Auswilderungsprojekten kann das Wissen um die Auswirkungen der Umgebung auf Exploration und Lernen dazu beitragen, die Tiere besser vorzubereiten und ihre Überlebenschancen zu erhöhen.
Zusammengefasst verdeutlichen die Beobachtungen und Analysen, dass Umweltbedingungen einen tiefgreifenden Einfluss auf das explorative Verhalten und die kognitive Entwicklung von Orang-Utans haben. Wild- und Zoo-Populationen weisen zwar grundlegende Ähnlichkeiten in der zeitlichen Entwicklung des Erforschens von Objekten auf, unterscheiden sich jedoch erheblich in der Häufigkeit, Vielfalt und Komplexität dieser Verhaltensweisen. Das Wissen um diese Unterschiede fordert dazu auf, bei der Bewertung von kognitiven Leistungen, insbesondere im Hinblick auf evolutionäre Schlüsse, die Haltungsbedingungen zu berücksichtigen. Es eröffnet gleichzeitig neue Perspektiven, wie Forscher durch vergleichende Studien wertvolle Einsichten hinsichtlich der Plastizität und des Potenzials der menschlichen und nicht-menschlichen Kognition gewinnen können.