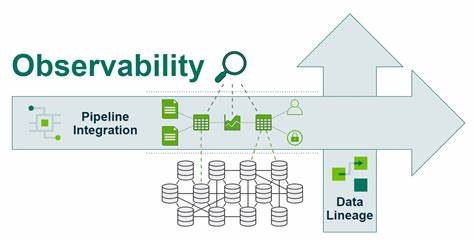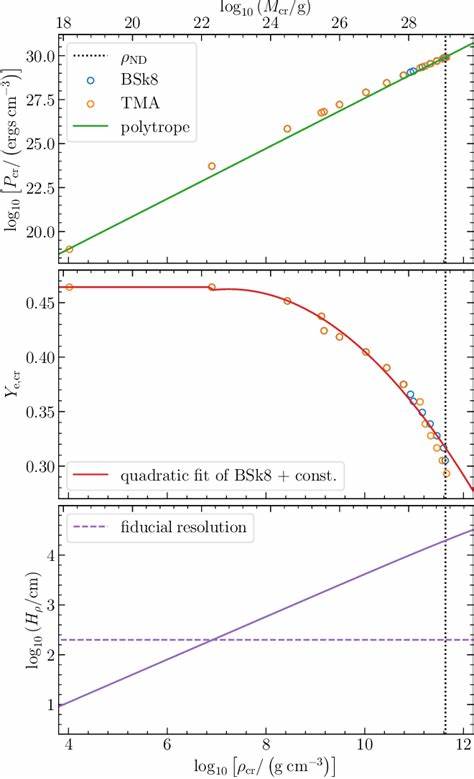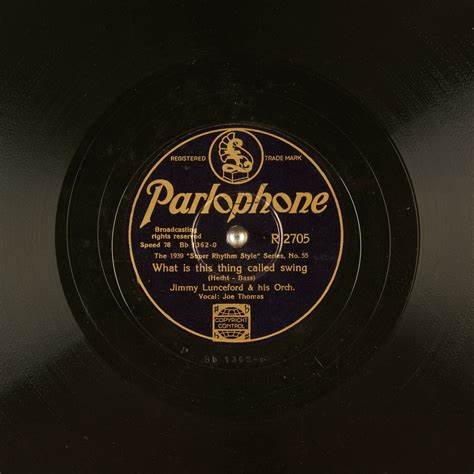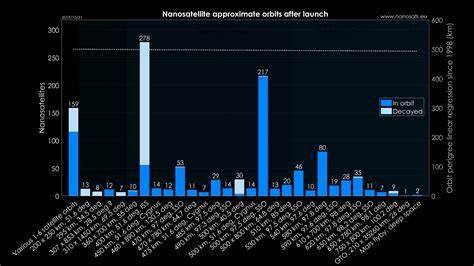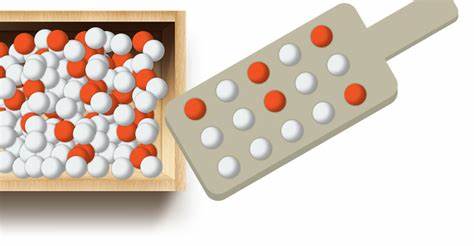Im Herzen des Amazonas-Regenwaldes sieht sich die Natur einer zunehmenden Bedrohung ausgesetzt: Der illegale Goldabbau rückt immer näher an monumentale Riesenbäume heran, darunter der zweitgrößte Baum des Amazonas, ein beeindruckender Roter Angelim (Dinizia excelsa) mit einer Höhe von 85 Metern. Diese gigantischen Bäume befinden sich innerhalb des Iratapuru Fluss-Schutzgebiets im brasilianischen Bundesstaat Amapá – einem Gebiet, das eigentlich unter Schutz steht. Dennoch haben illegale Goldgräber, sogenannte Garimpeiros, ihre Operationen nur noch etwa einen Kilometer von diesen Naturwundern entfernt ausgeweitet. Diese Entwicklung wirft beunruhigende Fragen bezüglich des Schutzes der Biodiversität, der Ökosysteme und der indigenen Gemeinschaften auf, die auf dieses empfindliche Ökosystem angewiesen sind. Historisch war Amapá im Vergleich zu anderen Bundesstaaten wie Pará und Roraima kein Hotspot für intensiven Goldabbau.
Doch die verstärkte Strafverfolgung gegen den illegalen Bergbau in diesen Nachbarregionen hat Garimpeiros dazu veranlasst, weiter nach Amapá zu ziehen. Diese Veränderung ist als ein besorgniserregender Trend zu werten, da sie nicht nur eine Verlagerung der Umweltzerstörung darstellt, sondern das Ökosystem des Amazonas in Amapá mit schwerer Belastung konfrontiert. Allein in den letzten Jahren sind Berichte aufgetaucht, dass Tausende illegaler Goldgräber aus indigenen Territorien wie Yanomami in Roraima vertrieben wurden und nun in Amapá neue Einsatzgebiete suchen. Die Praxis des Goldabbaus in Amapá hat sich somit dramatisch verändert: Während zuvor vor allem handwerkliche und vergleichsweise kleine Mining-Methoden vorherrschten, verfügen die neuen Miner über schweres Gerät, wie Bulldozer und Rückholbagger. Diese mächtigen Maschinen hinterlassen täglich tiefgreifende Spuren von Umweltzerstörung, wobei geschätzte 100 Meter Wald am Tag vernichtet werden.
Ein weiterer gravierender Faktor ist der erhöhte Einsatz von Quecksilber. Dieses Schwermetall wird genutzt, um Goldpartikel bei der Verarbeitung zu binden, führt jedoch zu massiver Kontamination der umliegenden Flüsse, Böden und letztendlich der gesamten Nahrungskette. Die Gefahr für das Amazonas-Biotop und seine Bewohner ist damit nicht nur auf direkten Waldverlust beschränkt. Die kontaminierten Flüsse bedrohen die Wasserversorgung und die Lebensgrundlage vieler indigener Völker, die seit Jahrhunderten in enger Symbiose mit dem Regenwald leben. Sie befürchten zurecht, dass die Verschmutzung ihre Jagd-, Fischerei- und Landwirtschaftsgrundlagen zerstört.
Außerdem besteht das Risiko, dass die Expansion der Minen in ihre Territorien vordringt, was zu weiteren sozialen Konflikten und Menschenrechtsverletzungen führen kann. Die Schwierigkeiten bei der Kontrolle und Überwachung der Region sind enorm: Der Standort der gigantischen Bäume ist praktisch nur per Hubschrauber oder einer mehrtägigen Bootsfahrt erreichbar. Dennoch gelingt es den illegalen Goldgräbern, selbst schweres Gerät durch mühselige Transporte in den Dschungel zu bringen, etwa durch das Zerlegen und Wiederzusammenbauen von Bulldozern. Dies zeigt die Entschlossenheit der Miner, trotz der logistischen Herausforderungen und des erhöhten Risikos weiter zu expandieren. Die hohen Goldpreise auf den Weltmärkten, verstärkt durch globale wirtschaftliche Unsicherheiten und politische Spannungen, sorgen zudem für finanzielle Anreize, die Risiken in Kauf zu nehmen.
Ein dramatisches Signal des Umweltrisikos war ein Dammbruch im Februar bei starkem Regen, der Bergbauabfälle in nahegelegene Flüsse wie den Cupixi und Araguari freisetzte. Solche Vorfälle setzen nicht nur das Ökosystem unter enormen Stress, sondern verstärken auch die Gefährdung der Wasserqualität und die Exposition der lokalen Bevölkerung gegenüber Giftstoffen. Die brasilianische Justiz reagierte bereits auf die wachsende Bedrohung: Im Oktober 2024 empfahl die Staatsanwaltschaft von Amapá, einen Schutzradius von mindestens einem Kilometer um jeden der sechs bedeutenden Riesenbäume einzurichten. Dieser Schutz soll als Pufferzone dienen, um direkten Bergbau und andere schädliche Aktivitäten fernzuhalten. Trotz dieses Vorschlags zeigt sich jedoch, dass die Umsetzung und Überwachung der Schutzmaßnahmen eine große Herausforderung darstellen.
Fachleute und Wissenschaftler illustrieren die Persistenz und das finanzielle Potenzial des illegalen Goldabbaus. Laut Luiz Jardim de Moraes Wanderley von der Fluminense Bundesuniversität investieren die Bergbau-Betreiber Überschüsse aus den extremen Goldpreisen in zusätzliche Ausrüstung, Transportmittel und neue Operationsgebiete. Diese Entwicklung perpetuiert einen Kreislauf der Zerstörung, der schwer zu durchbrechen ist, solange die Preise auf dem Weltmarkt hoch und die Kontrollen vor Ort unzureichend sind. Die Situation in Amapá ist ein Spiegelbild der globalen Herausforderungen im Kampf gegen illegale Ressourcenextraktion. Während Schutzgebiete und indigene Territorien rechtlich abgesichert sind, stoßen sie oft auf mangelnde Durchsetzungskraft und begrenzte Ressourcen zur Verhinderung illegaler Aktivitäten.
Der Goldrausch im Amazonasgebiet ist nicht nur ein lokales Umweltproblem, sondern ein globales Anliegen, da der Schutz dieser uralten Wälder auch für das Klima, die Biodiversität und indigene Kulturen von weltweiter Bedeutung ist. Ein weiterer Aspekt ist die politische Dimension: Die Strafverfolgung in bestimmten Bundesstaaten Brasiliens nahm ab 2023 zu, was die Garimpeiros zwang, ihre Aktivitäten in weniger überwachte Gebiete wie Amapá zu verlagern. Hier könnte eine verstärkte bundesstaatliche Zusammenarbeit und internationale Unterstützung helfen, um ein umfassendes Schutznetzwerk aufzubauen und illegale Minen zu beseitigen. Indigene Gemeinschaften spielen eine zentrale Rolle im Widerstand gegen diese Entwicklungen. Viele von ihnen engagieren sich aktiv für den Schutz ihrer Territorien und der Umwelt, trotz der oftmals prekären Sicherheitslage.



![Hackers Access Windows SMB Shares [video]](/images/E8C7EC23-78E9-431E-A2C5-647D23E34297)