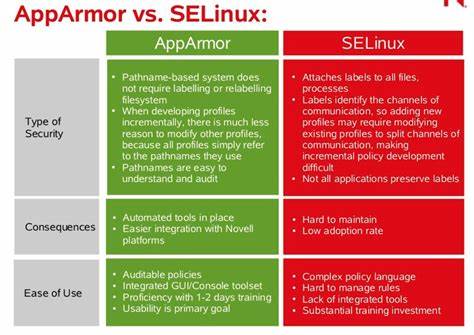Die Tiefsee, oft als der abgrundtiefe, mysteriöse Bereich des Ozeans wahrgenommen, entpuppt sich als eine zentrale Schaltstelle für biogeochemische Kreisläufe von Spurenelementen, die das marine Ökosystem und letztlich das globale Klima maßgeblich beeinflussen. Insbesondere der abyssale Meeresboden, definiert als die Zone unterhalb von etwa 5.000 Metern Tiefe, spielt eine entscheidende Rolle in der Steuerung der Verteilung und dem Recycling essenzieller Spurenelemente wie Neodym, Eisen, Mangan oder Kupfer. Spurenelemente, obwohl nur in winzigen Konzentrationen vorhanden, sind für das Leben im Ozean unverzichtbar. Sie fungieren als Nährstoffe für Mikroorganismen, Katalysatoren biochemischer Prozesse und als wichtige Indikatoren für die Erforschung von Ozeanprozessen und Veränderungen des Klimas.
Die traditionelle Sichtweise betrachtete die Verteilung von Spurenelementen vor allem unter dem Aspekt der sogenannten reversiblen Sorption oder Scavenging, wobei gelöste Elemente von Partikeln im Wasser aufgenommen und wieder freigesetzt werden, was hauptsächlich den Wasserkörper selbst kontrolliert. Neuere Forschungen haben allerdings gezeigt, dass auch die geochemischen Prozesse am Meeresboden eine starke Prägung auf die Konzentrationen und Isotopenzusammensetzungen dieser Elemente ausüben, insbesondere im abyssalen Bereich. Eine besondere Rolle nimmt dabei die Bindung der Spurenelemente an bestimmte Partikelarten ein. Biogene Partikel, wie Kalkschalen oder Kieselsäure, waren lange Zeit als Hauptträger dieser Elemente angesehen. Moderne Untersuchungen belegen jedoch, dass authigene Mineralien, vor allem Mangandioxid und Eisenoxide, deutlich größere Affinitäten für viele dieser Spurenelemente besitzen, insbesondere für seltene Erden und Neodym.
Obwohl diese Oxide im Wasser in sehr geringer Menge vorliegen, binden sie effektiv Spurenelemente und sorgen so für deren effizientere Entfernung aus der Wassersäule. Interessanterweise ist die Konzentration dieser Oxide mit zunehmender Wassertiefe höher, was bedeutet, dass eine permanente Nettoentfernung von Spurenelementen aus dem Wasserkörper durch diese Partikeltypen stattfindet. Dennoch zeigen viele Messungen in der Tiefsee steigende Konzentrationen bestimmter Spurenelemente mit der Tiefe, was zunächst paradox erscheint. Eine Erklärung für dieses Phänomen ist der benthische Fluss, also die Freisetzung von Spurenelementen aus den Sedimenten des Meeresbodens zurück ins Wasser. Die Prozesse, die diesen benthischen Fluss antreiben, sind eng mit der sogenannten oxischen Diagenese verbunden.
Dabei handelt es sich um chemische und mikrobiologische Reaktionen in sauerstoffreichen Tiefseesedimenten, die zur Umwandlung und Mobilisierung von Metallen führen. Partikulär gebundene Metalle werden dabei wieder freigesetzt und können durch turbulente Durchmischung über den Meeresboden in die Wassersäule gelangen. Diese turbulente Durchmischung ist insbesondere im abyssalen Bereich intensiv, da interne Gezeiten und die Topographie der Meeresbodengewässer starke Strömungsinstabilitäten erzeugen, welche die Durchmischung der Tiefenwasserschichten begünstigen. Das Verhältnis von Meeresbodenfläche zu Wasservolumen nimmt mit zunehmender Tiefe exponentiell zu. Dies vergrößert die Wirkung des benthischen Flusses auf die Konzentration der Spurenelemente im umgebenden Wasser, da relativ große Sedimentflächen auf ein vergleichsweise kleines Wasservolumen wirken.
Dabei ist vor allem der abyssale Meeresboden, der den Großteil der Ozeanfläche in großer Tiefe ausmacht, entscheidend für die Gesamtbilanz der Spurenelemente. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Herkunft der Spurenelemente, die aus den Sedimenten freigesetzt werden. Teilweise handelt es sich um recycelte Spurenelemente, die zuvor aus dem Wasserkörper auf Partikeln gebunden und in den Sedimenten abgelagert wurden. Daneben existiert aber auch ein „neuer“ Quellanteil, der aus der Verwitterung von marinen Silikaten in den Sedimenten stammt – ein Prozess, der bisher unterschätzt wurde. Diese neue Quelle ist besonders wichtig für Elemente wie Neodym und liefert nicht nur Material, sondern auch charakteristische isotopische Signaturen, die mit der Zeit und bei der Bewegung des Wassersystems die Isotopenverteilung im Ozean verändern.
Dieser Zusammenhang zwischen biogenen Partikeln an der Oberfläche (top-down-Prozesse) und benthischer Aktivität (bottom-up-Prozesse) bietet ein integriertes Verständnis des Spurenelementzyklus. Für Elemente mit hoher Affinität zu Oxiden dominieren die Prozesse am Meeresboden die Verteilung und Variabilität im Ozean, während andere Elemente, die stärker an biogene Partikel gebunden sind, eher einem top-down-Muster folgen. Die Erkenntnis, dass der abyssale Meeresboden wohl weit aktiver und biogeochemisch relevanter ist als lange angenommen, beeinflusst zahlreiche Forschungsbereiche. Aufgrund seiner Bedeutung ist der Meeresboden ein wesentlicher Faktor im globalen Kohlenstoffkreislauf, da Spurenelemente wie Eisen, Nickel oder Kupfer lebenswichtige Funktionen bei der Regulierung der biologischen Produktivität und somit auch beim atmosphärischen CO2-Gehalt einnehmen. Außerdem hat das Verständnis der benthischen Prozesse unmittelbare Auswirkungen auf das Interpretieren von marinen Isotopensignaturen, die als Tracer für Meereszirkulation und Klimaänderungen eingesetzt werden.
Durch die Berücksichtigung benthischer Quellen wird klar, dass diese Isotope nicht immer konservativ transportiert werden, sondern lokal und regional durch sedimentäre Prozesse verändert sein können. Durch moderne multidisziplinäre Ansätze, die chemische Analysen von Wassersäulenproben, Sedimentkernstudien und computergestützte biogeochemische Modellierungen vereinen, konnten Wissenschaftler die komplexe Wechselwirkung zwischen oxiden Partikeln, Sedimentsprozessen und der Tiefenwasserzirkulation besser aufschlüsseln. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von seltenerd-Elementen und Neodym-Isotopen als Tracer, die einzigartige Einblicke in den Kreislauf dieser Metalle bieten. Diese Fortschritte fordern auch die bestehenden Ozeanbiogeochemie-Modelle heraus, die bisher hauptsächlich auf top-down-Konzepten basierten und die Rolle der Sedimente unterschätzten. Durch die Einbeziehung eines realistischeren benthischen Flusses und genauerer Beschreibungen der Partikeltypen kann die Übereinstimmung mit beobachteten Konzentrationsprofilen und Isotopenverteilungen deutlich verbessert werden.
Zukünftige Forschung muss die globale Ausdehnung und Variabilität dieser benthischen Prozesse sowie ihre Sensitivität gegenüber Umweltveränderungen untersuchen. Insbesondere die Verknüpfung mit hydrothermalen Systemen, Sauerstoffminimumzonen, und der geologischen Beschaffenheit des Meeresbodens wird weitere wichtige Erkenntnisse liefern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der abyssale Meeresboden eine entscheidende, bisher unterschätzte Rolle in den biogeochemischen Zyklen der Spurenelemente spielt. Diese Erkenntnis erweitert unser Verständnis des marinen Elementkreislaufs, verbessert die Interpretation von Ozean-Tracern und vertieft das Wissen über die komplexen Wechselwirkungen zwischen Meereschemie, biologischer Produktivität und globalen Klimaänderungen.