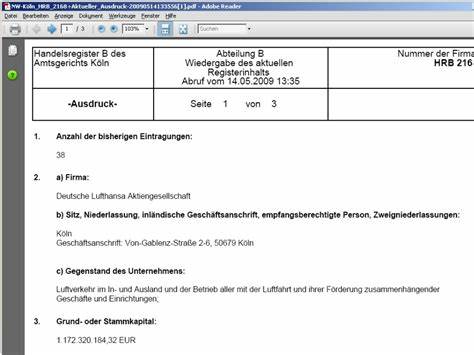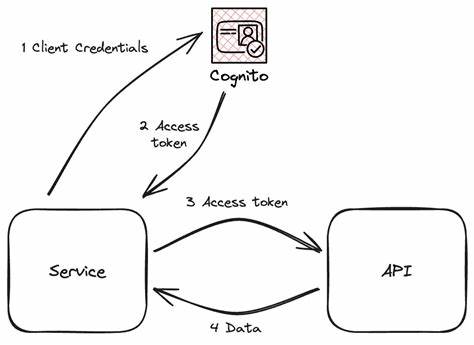Der Coleco Adam Computer stellt ein bemerkenswertes, wenn auch größtenteils vergessenes Kapitel der frühen Heimcomputer-Ära der 1980er Jahre dar. Als Spielzeughersteller und Anbieter von Videospielkonsolen versuchte Coleco im Jahr 1983 mit dem Adam den Sprung in den umkämpften Heimcomputermarkt zu schaffen und sich gegen Giganten wie Commodore und Atari zu behaupten. Obwohl das ambitionierte Projekt letztlich als Misserfolg endete, vermittelt der Coleco Adam heute wertvolle Einblicke in die damaligen Marktmechanismen, technische Herausforderungen und strategischen Fehlentscheidungen, die eine Computerfirma zu Fall bringen konnten. Dabei bleibt der Adam ein faszinierendes „Was-wäre-wenn“-Beispiel aus einer Zeit, in der der Markt für Heimcomputer noch nicht endgültig geformt war. Die Ursprünge von Coleco liegen in der Herstellung von elektronischen Spielzeugen und Unterhaltungselektronik.
In den 1970er Jahren zeichnete sich das Unternehmen durch sein Engagement im Videospielbereich aus und brachte diverse Pong-ähnliche Konsolen auf den Markt – darunter die Telstar-Reihe. 1982 folgte mit dem ColecoVision eine leistungsfähige Videospielkonsole, die sich dank eines Z80-Prozessors sowie Sound- und Grafikchips von Texas Instruments deutlich von der Konkurrenz abhob. Diese Konsole bot für die damalige Zeit Grafik und Sound auf einem Niveau, das näher am legendären Nintendo NES als an der Atari 2600 lag. Der Schritt zum Heimcomputer mit dem Adam war somit eine logische, wenn auch ambitionierte Weiterentwicklung. Der Heimcomputermarkt Anfang der 80er war eine äußerst dynamische Landschaft.
Commodore dominierte mit seinem Erfolgsgarant Commodore 64, einem 8-Bit-Computer, der durch seinen vergleichsweise günstigen Preis und sein umfangreiches Softwareangebot eine breite Käuferbasis angesprochen hatte. Doch auch Commodore hatte mit Problemen zu kämpfen, unter anderem in der Produktion und dem Vertrieb von Peripheriegeräten wie Diskettenlaufwerken und Druckern. Nachteil war, dass der Rechner allein wenig nützlich war; erst mit Zusatzgeräten konnte man die vollen Möglichkeiten ausschöpfen. Genau an dieser Stelle sah Coleco seine Chance. Sie präsentierten 1983 den Adam Computer als Komplettpaket, das alles enthielt – vom Computer mit 80 Kilobyte RAM über ein vollwertiges Keyboard bis hin zu einem Daisywheel-Drucker, Tape-Speicherlösungen und vorinstallierter Software wie dem Spiel „Buck Rogers: Planet of Zoom“ sowie einem Textverarbeitungsprogramm.
Die Idee, ein Komplettpaket anzubieten, unterschied den Adam von der Konkurrenz, die oft nur die Basisgeräte bereitstellten. Technisch setzte Coleco bei der Entwicklung des Adam auf einen Zilog Z80-Prozessor, der relativ gut programmierbar war und die Kompatibilität mit dem beliebten ColecoVision-Konsolensystem ermöglichte. Somit konnte der Adam nicht nur als eigenständiger Heimcomputer fungieren, sondern auch die Spielebibliothek der ColecoVision nutzen. Eine Erweiterung, die das reguläre ColecoVision in einen Computer verwandelte, war ebenfalls geplant. Dieses Konzept war nicht neu, doch 1983 schien die Technologie und der Markt reif für eine solche Integration.
Der Adam konnte damit eine Brücke zur Spielewelt schlagen und gleichzeitig Hausaufgaben und Produktivität ermöglichen – ein potenziell attraktives Gesamtpaket für Familien. Trotz vielversprechender Ansätze war der Weg von Coleco mit dem Adam von Problemen gepflastert. Die hohen Erwartungen verwandelten sich rasch in Enttäuschung, da das Produkt erst Monate später als angekündigt auf den Markt kam und nur in begrenzten Stückzahlen verfügbar war. Ursprünglich plante Coleco, im Jahr 1983 eine halbe Million Geräte zu verkaufen, doch tatsächlich wurden nur etwa 100.000 Einheiten produziert.
Besonders kritisch war die mangelhafte Qualität vieler Modelle. Mit einer Defektquote von laut Hersteller zehn Prozent und Händlerberichten, die von noch höheren Rückläufern sprachen, litten Kaufinteressenten schnell an einem schlechten Ruf der Maschine. Viele Kunden klagten über schwerwiegende technische Mängel oder Fehlfunktionen – etwas, was in der jungen und schnell wachsenden Computermarkt-Community nur schwer zu verkraften war. Das Speichermedium des Adam war ein weiteres Problem. Die sogenannten Digital Data Packs erinnerten zunächst an Audiokassetten, boten jedoch schnellere Zugriffszeiten als herkömmliche Bandlösungen.
Gleichzeitig blieben sie hinter der Performance von Diskettenlaufwerken zurück und hatten zudem eine Neigung zum Ausfransen des Bandstoffs. Noch schwerwiegender war der Umstand, dass sich die Magnetbänder manchmal durch das Einschalten des Systems beim Einlegen im Laufwerk unwiderruflich löschten oder beschädigten. Diese Unzuverlässigkeit sorgte für Frustration bei Usern, denn gerade für Produktivitätsaufgaben ist eine verlässliche Datenspeicherung essenziell. Auch der mitgelieferte Drucker war technisch gut umgesetzt, lieferte hochwertige Ergebnisse, war aber gleichzeitig laut, langsam und auf den einfachen Textdruck begrenzt. Grafikausgaben waren nicht möglich, was angesichts populärer Grafikprogramme auf anderen Plattformen ein Rückschritt schien.
Zudem hatte die Hardware einen entscheidenden Konstruktionsfehler: Der gesamte Computer wurde über das Netzteil des Druckers mit Strom versorgt. Fiel der Drucker aus, war auch der Computer nicht mehr betriebsbereit. Dieses Design, auch von anderen Herstellern in späteren Jahren übernommen, erwies sich als unnötiges Risiko. Gleichzeitig setzte Coleco in der Hardwarefertigung auf eingekaufte Chips von Zilog und Texas Instruments, während Konkurrent Commodore eigene Prozessoren entwickelte. Das Resultat war, dass Commodore flexibler in der Preisgestaltung und der Margenoptimierung war.
Selbst als Coleco später eine Diskettenlaufwerksoption für den Adam anbot und die CP/M-Kompatibilität des Systems gut funktionierte, konnte das Paket preislich nicht mit dem etablierten Angebot wie dem Commodore 64 und dessen Laufwerken konkurrieren. Die Anfänge des Coleco Adam fielen zudem in die Zeit des Videospiel-Crashs von 1983, der zwar Chancen für Heimcomputer brachte, aber auch den Wettbewerb verschärfte. Commodore nutzte seine Produktionsvorteile, um große Marktanteile zu sichern. Coleco dagegen verlor Zeit, Geld und Ansehen. Rückblickend war das schnelle Scheitern des Adam im Jahr 1985 kaum verwunderlich.
Die Schattenseite des fehlgeschlagenen Projekts zog sich bis zum Ende von Coleco um 1988, das die Bedeutung dieses Ausrutschers für die Unternehmensgeschichte unterstreicht. Neben den direkten technischen und geschäftlichen Problemen sorgte der Coleco Adam Computer auch für unerwartete Auswirkungen auf die Branche. Auf der Consumer Electronics Show (CES) 1983 zeigte Coleco eine erweiterte Version des Spiels Donkey Kong auf dem Adam – ein Titel, für den Atari sich schrankenlose Exklusivrechte erhoffte. Die Vorstellung des Adam mit Donkey Kong führte zur Eskalation zwischen Nintendo, dem Rechteinhaber, und Atari. Dies trug letztlich dazu bei, dass Atari die Nintendo-Lizenzverhandlungen abbrach, was wiederum den Weg für die Nintendo Entertainment System (NES) brachte, das mit einem anderen Anbieter auf den nordamerikanischen Markt kam.
Ohne den Adam und das daraus resultierende Lizenzchaos hätte das NES möglicherweise früher und unter Atari-Flagge den Markt betreten. Spekulativ gesehen hätte der Adam durchaus eine bedeutende Rolle in der Geschichte des Heimcomputerspiels und der Softwareentwicklung spielen können. Die Hardware war kompatibel mit vielen MSX-Standards, die in Japan erfolgreich waren, womöglich hätte sich hier ein plattformübergreifendes Ökosystem entwickeln können. Hätte Coleco die angestrebte Produktionsmenge erreicht und die Qualitätsprobleme beseitigt, wäre der Wettbewerb für Commodore deutlich härter ausgefallen. Die Folge hätte eine verschobene Entwicklung der Heimmärkte mit wohl spektakulären Auswirkungen auf die kommenden Computer- und Konsolengenerationen sein können.
Der Coleco Adam war sicherlich weit entfernt von einem perfekten System, doch betrachtete man ihn mit der Perspektive der heutigen Retrowelt, kann man seinen Charme und seine Nützlichkeit erkennen. Nutzer lobten beispielsweise die Tastatur und die Druckqualität im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Zudem war die Kompatibilität mit CP/M-Software ein großer Vorteil, da eine riesige Softwarebibliothek zugänglich wurde. Drittanbieter entwickelten zudem Erweiterungen, welche die Leistung und Einsatzmöglichkeiten des Adam erweiterten. Zusammenfassend zeigt die Geschichte des Coleco Adam Computers, wie eng Technik, Marktdynamik, Produktqualität und strategische Entscheidungen ineinandergreifen müssen, um im sich rapide entwickelnden Heimcomputermarkt der 1980er Jahre zu bestehen.
Fehlschläge wie beim Adam waren dabei nicht ungewöhnlich, auch wenn sie umso schmerzhafter ausfielen. In den letzten Jahren hat der Adam eine kleine, aber engagierte Fangemeinde gefunden, die seine Bedeutung und die Lektionen, die er erteilt, neu würdigt. Für Liebhaber der Computerpionierzeit bleibt der Adam ein faszinierendes Symbol für ambitionierte Innovation, die leider vom Markt überrollt wurde.