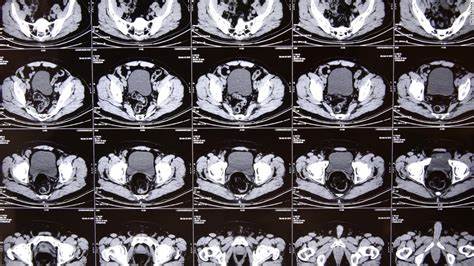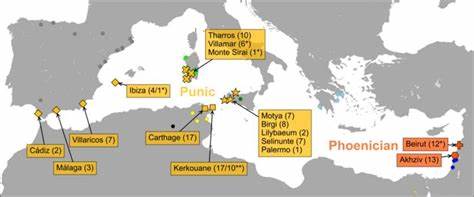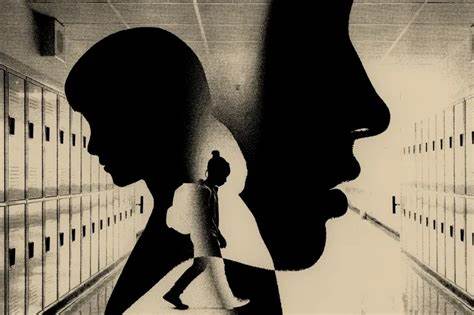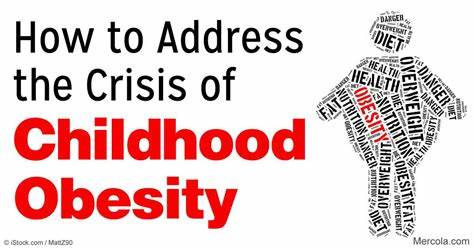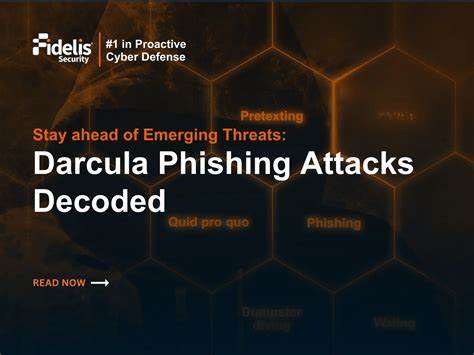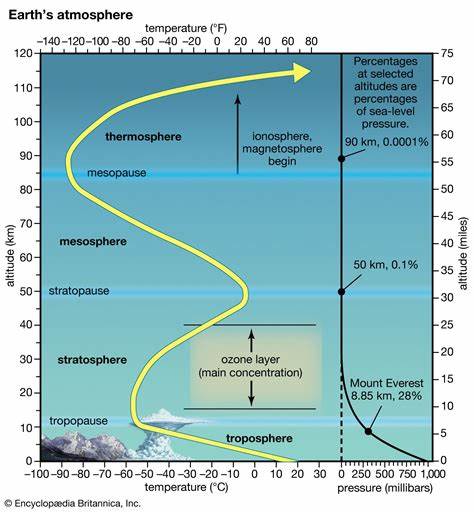Computed Tomography, kurz CT-Scan, gilt als unverzichtbares diagnostisches Werkzeug in der medizinischen Bildgebung. Seit seiner Einführung hat es die Art und Weise, wie Ärzte Krankheiten erkennen und behandeln, revolutioniert. Von der detaillierten Darstellung innerer Organe bis hin zur schnellen Diagnose bei Notfällen ist die CT ein wertvolles Instrument. Doch nun wirft eine neue, umfassende Studie aus den Vereinigten Staaten besorgniserregende Fragen über die potenziellen Langzeitfolgen des häufigen Einsatzes dieser Technologie auf. Die Erkenntnisse lassen vermuten, dass die Strahlenbelastung durch CT-Scans eine erhebliche Anzahl zukünftiger Krebserkrankungen verursachen könnte – eine Tatsache, die das öffentliche Bewusstsein und medizinische Fachkreise gleichermaßen alarmiert.
Die Daten basieren auf einer detaillierten Analyse von rund 93 Millionen CT-Untersuchungen, die allein im Jahr 2023 in den USA durchgeführt wurden. Die angeschlossenen Studienergebnisse prognostizieren, dass diese Strahlenexposition über das Leben der untersuchten Patientinnen und Patienten kumuliert ungefähr 103.000 neue Krebserkrankungen auslösen könnte. Dieser Wert bezieht sich auf Patienten unterschiedlichen Alters und berücksichtigt sowohl Erwachsene als auch Kinder. Dabei zeigt sich, dass trotz des erhöhten individuellen Risikos bei Kindern die überwältigende Mehrheit der potenziellen Krebsfälle auf Erwachsene zurückzuführen ist – schlichtweg wegen des weit größeren Anteils an CT-Untersuchungen bei dieser Altersgruppe.
Doch wie entsteht dieses Risiko? CT-Scans arbeiten mit ionisierender Strahlung, um detaillierte Querschnittsbilder des Körpers zu erstellen. Diese Strahlung kann DNA-Schäden in Zellen verursachen, was im ungünstigsten Fall zu Tumorbildungen führen kann. Zwar sind die Strahlendosen bei modernen CT-Geräten vergleichsweise gering, doch bei der enormen Anzahl an Untersuchungen summieren sich diese Dosen. Besonders problematisch ist die häufige Durchführung mehrphasiger Untersuchungen, bei denen derselbe Körperabschnitt mehrfach in unterschiedlichen Phasen abgebildet wird, was die Strahlenbelastung erhöht. Die Studie hebt hervor, dass die meisten durch CT induzierten Krebsfälle nach Untersuchungen des Bauch- und Beckensbereichs entstehen.
Diese Untersuchungskategorie macht allein knapp ein Drittel aller durchgeführten CT-Scans aus, gleichzeitig steht sie für etwa 40 Prozent der prognostizierten Krebserkrankungen. Entscheidend ist hier, dass viele Multiphasen-Scans vermeidbar wären, wenn die klinische Indikation sorgfältiger geprüft und nur erforderliche Phasen durchgeführt würden. Neben Bauch- und Becken-CTs sind auch Thorax-Scans, also Aufnahmen der Brustregion, stark mit künftigem Krebsrisiko verbunden. Eine differenzierte Betrachtung zeigt Geschlechts- und Altersunterschiede: Bei Kindern und Jugendlichen ist das Krebsrisiko pro CT-Untersuchung deutlich höher als bei Erwachsenen, da sich das Gewebe noch im Wachstum befindet und damit strahlenempfindlicher ist. Besonders bei Kindern unter einem Jahr ist pro Scan mit einem deutlich erhöhten Risiko zu rechnen.
Dennoch verursacht die größere Anzahl von CT-Scans bei Erwachsenen den Großteil der projizierten Krebsfälle. Hinsichtlich der Geschlechter waren Lungentumore bei weiblichen Patienten am häufigsten, gefolgt von Brustkrebs bei Frauen. Bei Männern dominierten Lungen- und Darmkrebs. Angesichts dieser Erkenntnisse stellt sich die Frage nach dem verantwortungsvollen Einsatz von CT-Untersuchungen im medizinischen Alltag. Die Untersuchung ist oft lebensrettend oder ermöglicht eine frühzeitige, präzise Diagnostik schwerer Erkrankungen.
Ihr Nutzen kann insbesondere in Notfallsituationen oder bei unklaren Beschwerden die Risiken überwiegen. Gleichzeitig besteht der weit verbreitete Trend zu Überuntersuchungen, teilweise aufgrund mangelnder Alternativen, einer defensive Medizinpraxis oder auch Druck von Patientenseite. Hierbei werden oft CT-Scans eingesetzt, obwohl andere, strahlenfreie oder strahlenarme Modalitäten wie Ultraschall oder Magnetresonanztomographie (MRT) möglich wären. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Anwendung ganzer Körper-CT-Scans aus Screening-Gründen, die von Direktanbietern außerhalb des regulären Gesundheitssystems trotzt fehlender wissenschaftlicher Evidenz immer noch vermarktet werden. Diese Screening-Scans können die Strahlenbelastung unnötig erhöhen und führen häufig zu Fehlbefunden, die weitere invasive und teils riskante Untersuchungen nach sich ziehen.
Die US Food and Drug Administration und medizinische Fachgesellschaften raten ausdrücklich davon ab, solche Ganzkörper-Scans ohne medizinische Indikation durchzuführen. Moderne CT-Technologien entwickeln sich zwar ständig weiter und ermöglichen inzwischen zum Teil erhebliche Reduktionen der Strahlenexposition. Neue Verfahren wie die photonenzählende CT können bei gleichbleibender oder verbesserter Bildqualität die Dosis um den Faktor zehn senken. Dennoch zeigen die aktuellen Zahlen, dass trotz technischer Verbesserungen die Menge der Untersuchungen zunimmt und somit die absolute Strahlenexposition und das Risiko krebserregender Effekte steigen können. Fachleute sind sich einig, dass deshalb drei Grundsätze in der CT-Diagnostik strikt umgesetzt werden müssen: Erstens darf eine CT-Untersuchung nur bei klarer medizinischer Indikation erfolgen.
Zweitens muss die Dosis so gering wie möglich gehalten werden, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen (As Low As Reasonably Achievable – ALARA-Prinzip). Drittens sollte auf die Anzahl der Untersuchungen pro Patient geachtet und die kumulative Strahlenexposition dokumentiert werden. Die vorgeschlagene Risikomodellierung hat zwar gewisse Unsicherheiten, insbesondere bei der Übertragung von Langzeitdaten aus Bevölkerungsstudien wie denen der Überlebenden der Atombombenabwürfe, ist aber allgemein anerkannt und durch vielfache Studien gestützt. Neben der BEIR VII-Norm (Biological Effects of Ionizing Radiation) wurde das Modell ergänzt um aktuelle CT-Dosisdaten aus einem umfangreichen CT-Dosisregister und epidemiologische Risikobewertungen. Die Studie macht auf einen weiteren kritischen Aspekt aufmerksam: Rund 10 Prozent der CT-Untersuchungen werden in der letzten Lebensphase durchgeführt.
Da der Zeitraum zwischen Strahlenexposition und Krebsentwicklung oft viele Jahre beträgt, sind diese Untersuchungen weniger relevant für das zukünftige Krebsrisiko. Indem diese „End-of-Life“-Scans aus der Analyse ausgeklammert wurden, erschien die Gesamtzahl der potenziell induzierten Krebsfälle noch alarmierender, da tatsächlich etwa 84 Millionen CT-Scans in Betracht gezogen wurden, die ein tatsächliches Risiko tragen. Auf gesellschaftlicher Ebene wirft diese Entwicklung Fragen zu den Kosten-Nutzen-Verhältnissen und zur Patientensicherheit auf. Da CT-assoziiertes Krebsrisiko perspektivisch bis zu 5 Prozent aller jährlichen Krebsfälle ausmachen könnte, bedarf es eines bundesweiten Bewusstseins für den richtigen Einsatz der Technologie. Denn es handelt sich um handhabbare Risiken, deren Minimierung in der Hand von Ärzten, Gesundheitssystemen und Patienten liegt.
Zur Vermeidung unnötiger Strahlenbelastung empfehlen Experten Schulungen für Mediziner zur angemessenen Bildgebung, verbindliche Leitlinien mit enteralen Einsatzkriterien und die Förderung von Alternativverfahren. Digitale Instrumente können helfen, die kumulative Dosis bei Patienten zu überwachen und so Risiken besser einzuschätzen. Auch die Aufklärung von Patienten über Nutzen und mögliche Nebenwirkungen von CT ist entscheidend für informierte Entscheidungen. Insgesamt liefert die aktuelle Studie eine klare Mahnung zur Wachsamkeit im Umgang mit CT-Scans. Die Risiken sind real, doch bei umsichtigem Einsatz sind sie kontrollierbar.
Die CT bleibt ein unverzichtbares Instrument in der Diagnostik modernen Medizin, deren Vorteile bei richtiger Anwendung weiterhin die Risiken weit überwiegen. Die Verantwortung liegt darin, unnötige und hochdosierte Scans zu vermeiden, individuell abzuwägen und das Strahlenrisiko konstant zu minimieren. So können Ärzte und Patienten gemeinsam dazu beitragen, das Potenzial von CT-Scans bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig die Entwicklung alarmierender Krebsfälle durch Strahlenexposition zu begrenzen. Nur so bleibt die Computertomografie ein sicherer Baustein moderner Gesundheitsfürsorge, der Leben rettet, ohne zukünftige Gesundheit aufs Spiel zu setzen.