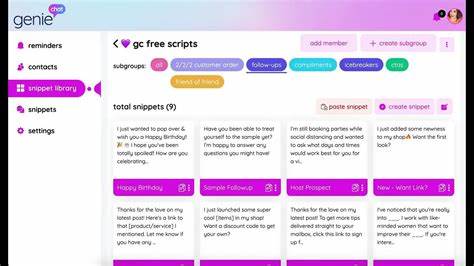Die industrielle Produktion hat im Laufe der Geschichte viele Wandlungen durchlaufen, von der manuellen Handarbeit über die klassische Fließbandfertigung bis hin zur Automatisierung und Digitalisierung. Eine besonders spannende Phase zeichnet sich heute durch den Einsatz digitaler Fertigungstechnologien aus, die man unter dem Begriff der „Dritten Industriellen Revolution“ zusammenfasst. Dazu zählen 3D-Drucker, CNC-Fräsmaschinen und Laserschneider, welche mit Software gesteuert werden und es ermöglichen, komplexe Objekte direkt am Computer zu entwerfen und anschließend in physische Produkte umzusetzen. Diese Technologien versprechen nicht nur technische Innovation, sondern könnten auch grundlegende Veränderungen in der Art und Weise bewirken, wie Güter produziert, verteilt und konsumiert werden. Anders als frühere Industrialisierungswellen könnten sie theoretisch eine Demokratisierung der Produktionsmittel fördern, indem sie unabhängige Maker – also Bastler, Erfinder und kleine Produzenten – befähigen, Produkte selbst herzustellen und herzustellen lassen.
Doch wie realistisch sind diese Hoffnungen? Und welche gesellschaftlichen Hintergründe und Interessen stehen hinter der Technologie? Um diese Fragen zu beantworten, ist es wichtig, nicht nur die technischen Aspekte der digitalen Produktion zu betrachten, sondern auch die soziale Geschichte der industriellen Fertigung und ihrer Automatisierung zu verstehen. Die Ursprünge moderner computergesteuerter Maschinen liegen in der Zeit des Kalten Krieges. Die Entwicklung der numerisch kontrollierten Maschinen, kurz N/C, kann auf militärische Programme zurückgeführt werden, deren Ziel es war, die Herstellung von Rüstungsgütern mit maximaler Präzision und Effizienz zu ermöglichen. Gleichzeitig wurden diese Technologien auch zur Schwächung von Gewerkschaften und Arbeiterorganisationen eingesetzt. Traditionell verfügten Facharbeiter über ein gewisses Monopol auf ihr Wissen über den Produktionsprozess und konnten so im Betrieb Macht ausüben.
Die Automatisierung zielte darauf ab, dieses Wissen zu kodifizieren, aus der Hand zu geben und in Programme umzuwandeln, die von Maschinen ursprüngliche menschliche Fähigkeiten übernahmen. Der Historiker David Noble hat in seinen Arbeiten prominent dargelegt, dass bereits frühe Pioniere wie Frederick W. Taylor versuchten, Arbeitsprozesse so zu systematisieren, dass Arbeiter daran gehindert wurden, die Firmen durch bewusst verlangsamte Arbeit zu benachteiligen. Die Programmierung von Maschinen ging damit einher, die Kontrolle über den Arbeitsprozess zu zentralisieren und Arbeitsleistung messbar und vergleichbar zu machen. Charles Babbage, oft als Begründer der Computertechnik betrachtet, bemerkte schon im 19.
Jahrhundert die Möglichkeit, Maschinen so zu konstruieren, dass sie Menschen gegenüber überlegen seien, wenn es darum geht, Nachlässigkeit oder Unehrlichkeit durch automatische Kontrolle auszuschalten. Seine visionären Konzepte fanden in der Nachkriegszeit in den N/C- und später CNC-Maschinen eine praktische Umsetzung. Dabei wurde der Wandel von einem universellen Maschinenpark zu Spezialmaschinen durch die Programmierung möglich. Ein Wechsel im Produktionsprogramm erforderte nun keinen physischen Umbau mehr, sondern nur das Einspielen neuer Codes. Mit der Verbreitung dieser Technologien veränderte sich auch der Arbeitsalltag in Fabriken grundlegend.
Lange Zeit galt die Handarbeit als Ausdruck von Produktivität und Fachwissen, doch die Einführung von Automatisierungstechnik führte zu monotone Tätigkeiten für die verbleibenden Arbeiter. Während sich einige die digitalen Fertigungstechniken der Zukunft als Renaissance der Handwerkskunst und der individuellen Kreativität vorstellen, sind sie in Wirklichkeit auch ein erlerntes Ergebnis der Umgehung oder gar Vernichtung des Arbeiterwissens durch technologische Kontrolle. Das in der Makerszene besonders gefeierte Projekt RepRap, ein Open-Source-3D-Drucker, entstammt der Welt der freien Software und verfolgt ambitiöse Ziele: die Demokratisierung der Produktionsmittel und das Ende einer Konsumgesellschaft, in der Güter größtenteils durch globale Lieferketten hergestellt, verteilt und gekauft werden. Die Vorstellung, dass man durch den Einsatz solcher Drucker Arbeitsplätze zurückholen und billige Outsourcing-Strategien überflüssig machen könne, wird häufig geäußert und hat einen gewissen medialen Hype ausgelöst. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich eine andere Realität.
Der Gewerkschaftsbund der Stahlindustrie in den USA hat auf den Maker Faires mit ihrer Botschaft „Made in America“ auch symbolisch die Widersprüche verdeutlicht: Maschinen, die früher zur Bekämpfung von Arbeitsplätzen eingesetzt wurden, dienen nun einem patriotischen Industriestolz, der auf der Fragilität der globalisierten Produktionsstrukturen und der Deindustrialisierung basiert. Die Euphorie der Einzelmacher steht somit in einem Spannungsverhältnis zu den Interessen großer Unternehmen und der Realität der Arbeitsmärkte. Ein weiterer relevanter Aspekt ist das geistige Eigentum. Die Produktionswissen war historisch oft Eigentum der Arbeiter selbst. In den USA wurde noch im 19.
Jahrhundert vor Gericht entschieden, dass Arbeitnehmer Recht auf die Nutzung ihres während der Arbeit erworbenen Wissens haben; Versuche von Arbeitgebern, strenge Eigentumsansprüche geltend zu machen, stießen auf Widerstand, weil sie der Sklaverei nahekamen. Doch mit der zunehmenden Kodifizierung von Wissen und Etablierung neuer Formen geistigen Eigentums verschob sich die Macht zugunsten der Unternehmen. Heute stellen Urheberrechte, Patente und Softwarelizenzen zentrale Barrieren für die freie Nutzung und Weiterentwicklung von Produktionsmitteln dar. Die Creative-Commons- und Open-Source-Bewegungen versuchen, dem entgegenzuwirken, doch warnende Stimmen verweisen darauf, dass gerade im Zeitalter der Crowdworking-Plattformen Formen existieren, in denen Menschen für sehr geringe Entlohnungen Aufgaben erledigen – eine Form der Selbstausbeutung, die keineswegs mit den Idealen der Makerszene übereinstimmt. Die Integration von Heim-3D-Druckern in flexible Fertigungslinien ist kein Wunschtraum mehr, sondern bereits in Planung.
Diese Entwicklung könnte zu einem verstärkten Lohndruck führen, da Unternehmen Produktionskosten senken und Produktionsphasen stärker automatisieren können. Die Frage, wie diese Technologie genutzt wird, ist daher nicht nur technologisch, sondern vor allem politisch und sozial zu beantworten. Es geht um den Schutz von Arbeitsbedingungen, fairen Zugang zu Technologien und den kreativen Umgang mit geistigem Eigentum. Von großer Bedeutung ist dabei auch die Perspektive der Konsumenten. Ein Argument, das von Unterstützern wie Adrian Bowyer, dem Initiator von RepRap, vorgebracht wird, ist, dass niedrigere Preise und einfachere Zugänge zu Produkten den Konsum beeinflussen und so eine Entlastung für Arbeitnehmer bewirken könnten.
Dennoch bleibt unklar, ob sich diese theoretisch positive Wirkung langfristig so entfalten wird, oder ob sich neue Formen wirtschaftlicher Unausgewogenheiten und Abhängigkeiten manifestieren. Insgesamt steht die digitale Fertigung an einem Scheideweg. Während einige Hobbyisten und unabhängige Entwickler nach einer dezentralisierten, demokratischen Produktionsweise streben, verfolgen Investoren, Unternehmen und Rechtsvertreter ganz andere wirtschaftliche Interessen. Diese Divergenz zeigt sich exemplarisch in den Forderungen aus den 1980er-Jahren durch die Internationale Vereinigung der Maschinenarbeiter, die eine stärkere Einbindung der arbeitenden Bevölkerung in die Entscheidungen über neue Technologien und deren Gewinne forderte. Diese Idee ist heute aktueller denn je.
Die Story hinter den technologischen Errungenschaften und die politischen Fragen, die sich daraus ergeben, sind eng miteinander verbunden. Für die Zukunft der Produktion ist ein besseres Verständnis dieser Zusammenhänge nötig, um Technologie nicht nur als Technik zu begreifen, sondern als gesellschaftliches Feld, auf dem Macht, Wissen und Arbeit neu verteilt werden. Nur so lassen sich Chancen wie Risiken der digitalen Fertigung gleichermaßen einschätzen und gestalten.
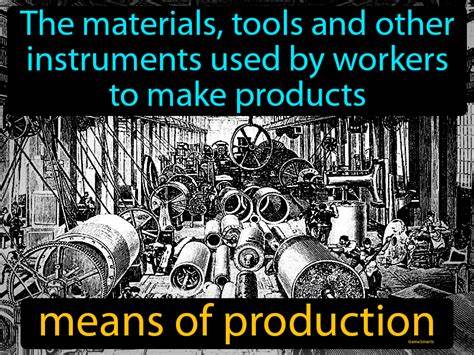



![Properties and Best Uses of Visual Encodings (2012) [pdf]](/images/A5AA7172-7704-4B0C-8ECC-AECBAF80C2D3)
![Voir Dire Training (2015) [pdf]](/images/F09213A9-5530-481A-AA90-6AA1462B8AC3)