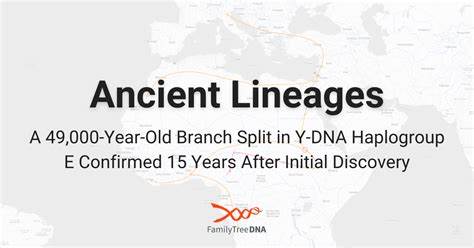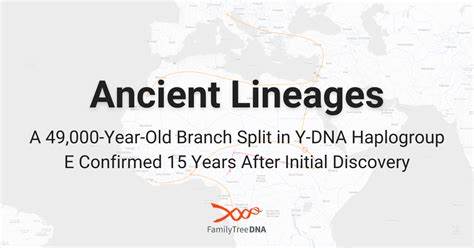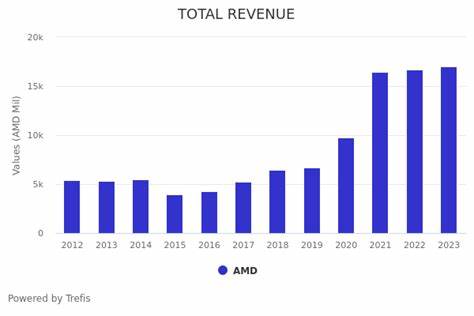Die Sahara gilt heute als eine der unwirtlichsten Wüstenregionen der Erde, doch vor etwa 14.500 bis 5.000 Jahren war dies ein blühendes, grünes Ökosystem mit reichhaltiger Vegetation und zahlreichen Gewässern. Die Phase, die als Afrikanische Feuchteperiode (African Humid Period, AHP) bekannt ist, ermöglichte Menschen eine breite Besiedlung und die Entwicklung früherer kultureller Praktiken wie der Viehzucht. Trotz der archäologischen Funde war bislang nur wenig über die genetische Herkunft der Menschen aus dieser Zeit bekannt, da das heiße und trockene Klima der Sahara schlechten DNA-Erhalt begünstigt.
Die jüngsten Erkenntnisse aus der Untersuchung antiker DNAproben aus der Grünen Sahara verändern diese Situation grundlegend und liefern wichtige neue Erkenntnisse über die Ursprünge der nordafrikanischen Bevölkerungen. Die wegweisende Studie basiert auf der Analyse von zwei etwa 7000 Jahre alten weiblichen Individuen, deren Überreste im Takarkori-Felsenshelter in der zentralen Sahara, im heutigen Südwesten Libyens, geborgen wurden. Diese Menschen lebten während der sogenannten Pastoral-Neolithikum-Periode, als sich in der Sahara erste Hirtengesellschaften etablierten. Durch den Einsatz moderner Methoden der Genomsequenzierung konnten Forscher erstmals das gesamte Erbgut dieser Individuen rekonstruieren, trotz der sehr geringen Menge überlebter DNA. Die Ergebnisse zeigen, dass die Takarkori-Frauen einer zuvor unentdeckten genetischen Linie angehörten, die tief in Nordafrika verwurzelt ist und sich frühzeitig von den Linien der Subsahara-Afrikaner getrennt hat.
Bemerkenswert ist, dass diese Linie zeitgleich mit den heutigen Menschen außerhalb Afrikas divergiert ist, somit also eine lange isolierte Entwicklungslinie darstellt. Zudem weisen die genetischen Profile eine Nähe zu vorangegangenen Populationen aus dem Nordwesten Afrikas auf, insbesondere zu den etwa 15.000 Jahre alten Forager-Gruppen aus der Taforalt-Höhle in Marokko, die mit der Iberomaurusischen Kultur in Verbindung gebracht werden und somit bereits vor der Afrikanischen Feuchteperiode lebten. Besonders auffällig ist die genetische Distanz zu den Subsahara-Afrikanern, was darauf hindeutet, dass es während der Zeit der Grünen Sahara kaum genetischen Austausch zwischen Südnord- und Nordsahara gab. Diese Erkenntnis steht im Gegensatz zur Vorstellung, dass die Feuchtphase breite und intensive Migrationen quer durch die Sahara gefördert hätte.
Stattdessen scheint die Sahara trotz ihrer grünen Phase als genetische Barriere gewirkt zu haben. Ein weiteres wichtiges Ergebnis betrifft den Anteil an Neandertaler-DNA. Während heutige Menschen außerhalb Afrikas typischerweise zwischen ein bis zwei Prozent Neandertaler-DNA in sich tragen, zeigen die Takarkori-Individuals deutlich weniger Neandertalerbeimischung als beispielsweise neolithische Gruppen aus dem Nahen Osten, aber mehr als moderne Subsahara-Afrikaner. Dies bestätigt, dass die TakarkoriPopulation teilweise Abkömmlinge jener Gruppen mit Außeraffikanischen Wurzeln sind, die jedoch nicht vollständig mit ihnen vermischten. Eine spannende Schlussfolgerung betrifft die Verbreitung der Viehzucht in der Grünen Sahara.
Archäologische Befunde hatten lange diskutiert, ob sie durch Migration von Bevölkerungsgruppen aus dem Nahen Osten bedingt war oder hauptsächlich durch kulturelle Diffusion, also Wissens- und Technologietransfer unter bestehenden Bevölkerungen. Die genetischen Befunde unterstützen eindeutig Letzteres. Die Takarkori-Frauen tragen nur geringe genetische Spuren von Menschen aus dem Nahen Osten, obwohl sie als Hirten lebten. Dies belegt, dass Viehzucht, obwohl kulturell von außerhalb eingeführt, von einer autochthonen, tief verwurzelten nordafrikanischen Population übernommen wurde. Darüber hinaus stellt die Studie das bisherige Modell zur Zusammensetzung der Taforalt-Bevölkerung in Frage, welche ursprünglich als Mischpopulation zwischen levantinischen Natufiern und einem unbekannten Subsahara-Anteil angesehen wurde.
Nun ergab sich, dass der als „sub-saharisch“ betrachtete Anteil tatsächlich eher eine Fähigkeit einer tief divergierten nordafrikanischen Linie ist, die auch in Takarkori vertreten ist. Diese verfeinerte Sichtweise betont die Eigenständigkeit und Komplexität der früh-nordafrikanischen genetischen Landschaft. Die trockenen Bedingungen der heutigen Sahara begünstigen normalerweise keinen DNA-Erhalt, sodass es bis jetzt kaum genomweite Studien aus der Region und Zeitalter gab. Der Takarkori-Felsenshelter mit seinen gut erhaltenen menschlichen Überresten und die Anwendung moderner DNA-Technologien ermöglichen nun erstmals eine detailreiche Rekonstruktion der Bevölkerungsstrukturen jener Zeit. Die Wissenschaftler verwendeten unter anderem DNA-Capture-Technologien, um gezielt interessante genetische Abschnitte trotz niedriger DNA-Mengen auszulesen.
Neben genetischen Analysen trug auch das Studium von Materialkultur, Felsmalereien und Artefakten zum besseren Verständnis der Bevölkerungsbewegungen und kulturellen Entwicklungen im frühen Holozän der Sahara bei. So zeugen Funde von Keramik, Jagdwaffen und Überresten domestizierter Tiere von einem längeren Zeitraum menschlicher Präsenz mit stetiger kultureller Weiterentwicklung. Dabei scheint die genetische Kontinuität besonders hoch zu sein, was auf ein beständiges Bevölkerungskerngebiet hinweist. Die Studie verbunden mit isotopischen Untersuchungen zeigte auch, dass die Bewohner des Takarkori-Gebiets eine relativ lokale Herkunft hatten und keine größeren Wanderbewegungen aufwiesen, was sowohl dem Konzept von genetischer Isolation als auch einem stabilen Überleben in der Grünen Sahara entspricht. Abschließend unterstreichen diese Forschungsergebnisse, wie menschliche Populationen in Nordafrika in einer dynamischen Umwelt agierten, mit einer tiefen Verwurzelung in einer isolierten genetischen Linie und einem komplexen Zusammenspiel von kultureller Innovation und Bevölkerungsentwicklung.