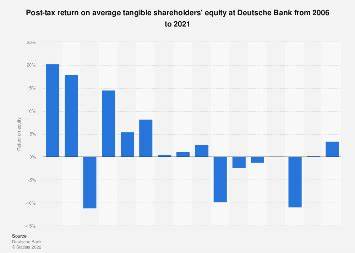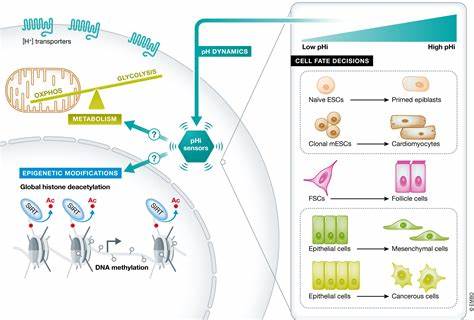Google steht im Vereinigten Königreich vor einem bedeutenden juristischen Verfahren, bei dem eine mögliche Entschädigungssumme von über einer Milliarde Pfund auf dem Spiel steht. Der Rechtsstreit dreht sich um die Gebühren, die Google von Entwicklern für den Verkauf digitaler Inhalte über den Play Store verlangt. Laut der Klageschrift soll Google seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben, um überhöhte und ungerechtfertigte Kommissionen einzufordern, was vielen kleinen und mittleren App-Entwicklern in Großbritannien erheblichen Schaden zugefügt haben soll. Die Wettbewerbskontrollbehörde des Vereinigten Königreichs hat dem Fall nun grünes Licht gegeben, sodass er im Oktober 2026 vor einem Gericht verhandelt werden kann. Sollte das Urteil gegen Google ausfallen, stehen Unternehmen und Entwicklern schätzungsweise 1,04 Milliarden Pfund an Kompensation zu.
Der Kern des Rechtsstreits liegt in der Praxis Googles, Entwicklern eine Provision von bis zu 30 Prozent auf Verkäufe digitaler Inhalte über den Play Store in Rechnung zu stellen. Für kleinere Entwickler mit einem Jahresumsatz von weniger als einer Million US-Dollar gilt jedoch eine reduzierte Gebühr von 15 Prozent. Gleichwohl wird von den Klägern bemängelt, dass diese Regelung zur Benachteiligung zahlreicher Entwickler beiträgt und Google seine überragende Marktposition ausnutze, um den Wettbewerb einzuschränken und Innovationen zu behindern. Der prominente Vertreter der Klage, Professor Barry Rodger, ein Fachmann für Wettbewerbsrecht, erklärt, dass Googles Vorgehen insbesondere kleineren britischen Entwicklern erheblichen Nachteil bringe und deren Wachstumspotenzial einschränke. Zu den Vorwürfen zählt unter anderem, dass Google verschiedene technische und vertragliche Beschränkungen implementiert hat, um alternative Vertriebskanäle für Android-Apps zu behindern oder zu erschweren.
Obwohl das Android-System im Vergleich zu Apples iOS ein wesentlich offeneres Ökosystem bietet und das sogenannte Sideloading – also die Installation von Apps außerhalb des Play Stores – technisch möglich ist, schränkt Google nach Ansicht der Kläger diese Möglichkeiten stark ein. Dies verhindere effektiv, dass Entwickler auf günstigere oder flexiblere Vertriebsmethoden ausweichen können. Der Fall ist eingebettet in einen globalen Kontext, da Google auch in der Europäischen Union unter der Lupe der Wettbewerbshüter steht. Die Europäische Kommission untersucht derzeit, ob Google gegen die Digital Markets Act (DMA) Bestimmungen verstoßen hat, insbesondere in Bezug auf die Bevorzugung eigener Dienste und die Behinderung von günstigeren Drittanbieterangeboten. Parallel dazu häufen sich auch in den USA ähnliche Klagen gegen Google und auch gegen andere Big Tech Unternehmen wie Apple, die ebenfalls wegen ihrer App Store Praktiken in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sind.
Apple erhebt für den Verkauf digitaler Inhalte im App Store standardmäßig 30 Prozent Gebühren, was ebenfalls in der Kritik steht. Doch im Gegensatz zum Apple-Ökosystem ist Android offen für Drittanbieter-App-Stores, eine Tatsache, die Google in seiner Verteidigung hervorhebt. Google selbst bestreitet jedoch jegliches Fehlverhalten und hebt die Vorteile hervor, die das Unternehmen App-Entwicklern auf der Plattform biete. In einer Stellungnahme wurde betont, dass Android ein hohes Maß an Flexibilität biete, einschließlich mehrerer App-Stores und der Möglichkeit des Sideloadings, was auf anderen Plattformen nicht in gleichem Maße möglich sei. Außerdem verteidigt Google seine Gebührenstruktur als wettbewerbsfähig, da 99 Prozent der Entwickler von einem vergünstigten Satz von 15 Prozent oder weniger profitieren würden.
Google kündigte an, die Klage energisch zu bekämpfen, da man überzeugt sei, dass die Gebühren angemessen seien und dem freien Wettbewerb förderlich seien. Der gesamte Fall wirft ein Schlaglicht auf die zunehmenden Spannungen zwischen großen Technologieplattformen und der weltweiten Regulierungslandschaft. Insbesondere in Bezug auf digitale Märkte und App-Vertriebssysteme wächst der Druck auf Unternehmen wie Google, ihre Praktiken transparenter und fairer zu gestalten. App-Entwickler fordern schon länger alternative, kostengünstigere Wege, um ihre Produkte zu vertreiben, ohne dabei einen Großteil ihrer Einnahmen an die Betreiber der Plattformen abgeben zu müssen. Die entstehende rechtliche Auseinandersetzung markiert einen wichtigen Meilenstein für den Schutz von kleineren Unternehmen im digitalen Ökosystem.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines negativen Urteils für Google wären beträchtlich. Neben der direkten Zahlung von möglichen Entschädigungen in Milliardenhöhe könnte das Urteil auch weitreichende Folgen für die zukünftige Geschäftspraxis im App-Store-Bereich haben. Fehlende Anpassungen könnten weitere regulatorische Eingriffe oder gar eine Zerschlagung von Geschäftsmodellen nach sich ziehen, die auf hohen Provisionen basieren. Dies könnte wiederum eine Neuordnung des mobilen App-Marktes zur Folge haben, die nicht nur Google oder Apple betrifft, sondern auch zahlreiche Entwickler und Verbraucher beeinflusst. Aus Sicht der britischen Behörden sowie vieler Marktexperten ist das Verfahren ein notwendiger Schritt zur Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs auf digitalen Plattformen, der Innovation fördert und gleichzeitig kleine und mittelständische Unternehmen schützt.
Gerade das Innovationsklima in Großbritannien könnte durch faire Bedingungen auf Plattformen wie dem Play Store profitieren, was mittel- bis langfristig auch die Wettbewerbsfähigkeit der britischen Tech-Szene stärkt. In der Zwischenzeit bleiben viele Entwickler und Unternehmen angespannt, da die Möglichkeit besteht, dass sie an der Klage teilnehmen können, sofern sie sich nicht aktiv dagegen entscheiden. Die Aussicht auf eine mögliche Entschädigung sorgt für Aufsehen und hat bereits eine Vielzahl von App-Entwicklern und Verlagen dazu bewegt, ihre Optionen zu prüfen. Auch wenn das Verfahren erst Mitte 2026 in die gerichtliche Phase eintritt, steht schon jetzt fest, dass die Auswirkungen weit über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinauswirken werden. Der Ausgang des Falls könnte als Präzedenzfall dienen, nicht nur für künftige Regulierungen und Wettbewerbsklagen, sondern auch für die Verhandlungspositionen großer Technologiekonzerne weltweit.