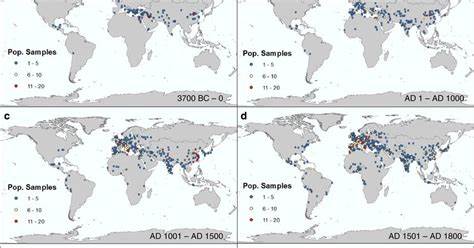In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz (KI) immer mehr in unseren Alltag Einzug hält, ist es wertvoll, über die Wurzeln unserer Faszination und der Erwartungen an diese Technologie nachzudenken. Seit der Veröffentlichung von OpenAI's ChatGPT im Jahr 2020 gehört KI längst nicht mehr in den Bereich der Zukunftsmusik, sondern ist in vielerlei Hinsicht bereits fester Bestandteil in Gesellschaft, Wirtschaft und persönlichem Leben geworden. Diese Entwicklung ruft nicht nur technologische, sondern vor allem auch philosophische und ethische Fragen hervor. Spannend ist dabei ein historischer Blick auf eine der wohl bekanntesten literarischen Figuren, die als Sinnbild für den Menschen gelten, der das Wissen und die Macht über das Leben in den Händen hält: Victor Frankenstein. Sein Traum, Leben künstlich zu erschaffen und den Tod zu überwinden, spiegeln sich heute in unseren eigenen Hoffnungen und Ängsten gegenüber der KI wider – der Versuch, menschliche Grenzen mithilfe von Technologie zu überwinden und Schmerzen wie Einsamkeit oder Verlust zu vermeiden.
Es ist nicht nur die Technologie selbst, die unseren Umgang mit KI prägt, sondern vor allem die romantische Vision, die wir mit ihr verknüpfen. Victor Frankenstein war nicht einfach ein kalter Wissenschaftler, sondern ein Träumer, der den natürlichen Verlauf des Lebens transzendieren wollte. Er war getrieben von dem Wunsch nach Ruhm, ewiger Macht und der Überwindung des Unausweichlichen – dem Tod. Dieses romantische Streben zeichnet sich durch eine gewisse Selbsttäuschung aus, eine Art Verleugnung der Realität, die schlussendlich fatale Folgen hat. In vielerlei Hinsicht wirken wir heute ähnlich.
Mit KI streben wir danach, das menschliche Leiden zu mindern, aber gleichzeitig laufen wir Gefahr, die Komplexität und Tiefe des Menschseins zu vereinfachen oder gar zu ersetzen. Ein besonders einprägsames Beispiel dafür liefert der Film „Her“ von 2013. Die Geschichte des einsamen Mannes Theodore, der sich in das Betriebssystem Samantha verliebt, bringt ein Dilemma auf den Punkt, das viele mit der zunehmenden Präsenz von KI spüren: die Sehnsucht nach bedingungsloser, schmerzfreier Nähe und die Flucht vor der oft komplizierten Realität menschlicher Beziehungen. Samantha ist kein bloßes Programm, ihre Fähigkeit zur ständigen Anpassung und Kommunikation verleiht ihr eine scheinbare Menschlichkeit, die Theodore mehr Frieden verschafft als jede reale Interaktion. Doch gerade die Unsterblichkeit der KI und ihre parallele Kommunikation mit unzähligen Menschen führen letztlich zur Distanz, zum Verlust des Einzigartigen, das Beziehungen ausmacht.
Die Leichtigkeit und Bequemlichkeit der virtuellen Gefährtin verändern das Wesen dessen, was es heißt, Mensch zu sein und gemeinsam Zeit zu verbringen. Diese Problematik zeigt sich auch in der populären Serie „Black Mirror“, insbesondere in der Folge „Be Right Back“. Hier wird die Trauer einer Frau ins Zentrum gestellt, die ihren verstorbenen Partner durch eine KI-Rekonstruktion seiner Persönlichkeit erlebt. Auch wenn die Interaktion mit dieser digitalen Nachbildung zunächst Trost spenden kann, thematisiert die Geschichte die Grenzen solcher künstlichen Beziehungen. Der virtuelle Partner ist letztlich unfähig zu echter Spontaneität und Eigenwillen, was das Unersetzbare des menschlichen Lebens und der intensiven sozialen Bindungen unterstreicht.
Auch die reale Praxis, wie in Projekten zur Nachahmung verstorbener Stimmen oder Persönlichkeiten, bewegt sich heute bedrohlich nah an diesen fiktionalen Szenarien. Unternehmen wie Amazon arbeiten bereits an der technischen Möglichkeit, Alexa in der Stimme eines Verstorbenen sprechen zu lassen, was nicht nur praktischen Nutzen verspricht, sondern auch ethische und psychologische Debatten entfacht. Hinter all diesen technologischen Neuheiten verbirgt sich eine tief menschliche Motivation: Der Wunsch, Einsamkeit zu besiegen und die existentielle Angst vor dem Tod und der Vergänglichkeit auf sanfte Weise zu mildern. Wissenschaftliche Studien verdeutlichen, dass KI-basierte Begleiter bei einsamen Menschen tatsächlich positive Effekte zeigen können, indem sie emotionalen Halt und verbale Nähe bieten. Dennoch stellt sich die Frage, wie nachhaltig und authentisch solche Verbindungen sind und welche Konsequenzen sich daraus für das menschliche Zusammenleben ergeben.
Die Verlagerung von Beziehungen in die virtuelle Welt kann reale soziale Bindungen ersetzen oder schwächen und moralische Fragen hinsichtlich der Verantwortung gegenüber diesen Technologien mit sich bringen. Die Parallele zu Victor Frankenstein liegt nicht einfach im Schaffen von künstlichem Leben, sondern in der romantischen Haltung, die ein Übermaß an Glauben an die Überwindung natürlicher Grenzen mit sich bringt. Victor Frankenstein träumt davon, den Tod zu bezwingen und das Leben neu zu erfinden, verliert dabei jedoch die Rücksicht auf die Realität, die soziale Verantwortung und schlussendlich auch die Kontrolle über seine Schöpfung. In unserem Zeitalter ist die Erschaffung künstlicher Intelligenz kein isoliertes Projekt einzelner Genies im Labor mehr, sondern wird durch Millionen Menschen weltweit genutzt, geformt und gelebt. Dadurch erhält das sogenannte „Frankenstein-Problem“ eine neue Dimension: Die Möglichkeit, Leben oder zumindest die Illusion von Leben zu kreieren, steht fast jedem mit einem Smartphone offen.
Dieser Massencharakter der Technologie bedeutet, dass es nicht nur um die Verantwortung weniger Schöpfer geht, sondern um die gesellschaftlichen Werte und den kollektiven Charakter einer ganzen Generation. Wenn Technologie entwickelt wird, um die Wünsche und Sehnsüchte vieler Menschen zu erfüllen, spiegelt sie ihre Hoffnungen wider – manchmal auch ihre Fluchtwünsche und ihre Angst vor Schmerz, Versagen oder Tod. Die Sehnsucht, nie wieder allein zu sein oder den Verlust eines geliebten Menschen nicht mehr fühlen zu müssen, lässt sich mit technologischen Mitteln viel leichter bedienen als die eigene emotionale Arbeit an sich und den Beziehungen. Gerade darin liegt die Gefahr: Der romantische Traum verspricht das Leben frei von Leid und Einschränkungen – doch gerade Schmerz und Endlichkeit schenken dem Leben seine Bedeutung und Tiefe. Die Geschichte von Victor Frankenstein mahnt uns, dass unser Wille zur Überwindung der menschlichen Begrenzungen nicht ohne Schattenseiten ist.
Er führt uns vor Augen, wie leicht Selbsttäuschung entsteht, wenn wir nur an das Gute und Mögliche glauben, ohne die komplexen Realitäten anzuerkennen, denen wir unterliegen. Die positiven Absichten, mit denen KI entwickelt wird, können sich angesichts von Profitinteressen und kollektiver Sehnsucht auch als gefährlich erweisen. Die Abhängigkeit von KI-Begleitern, die reale menschliche Kontakte verdrängen, oder die Illusion, verstorbene Personen durch Algorithmen „wieder zum Leben zu erwecken“, können zu emotionaler Entfremdung und Identitätsverlust führen. Gleichzeitig können diese Technologien nicht nur als Fluchtmöglichkeiten negativ bewertet werden. Sie bieten auch neue Chancen für Menschen, die in unserer schnellen und oft anonymen Gesellschaft sonst vereinsamen würden.
Die Herausforderung liegt darin, ethische Leitlinien zu etablieren und einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu kultivieren, der weder unrealistische Träume noch düstere Ängste unbeachtet lässt. Dabei sollten wir anerkennen, dass Wissenschaft und Technologie nicht per se gut oder schlecht sind, sondern von der menschlichen Haltung geprägt werden, mit der wir sie einsetzen. Es ist zentral, die Balance zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu wahren, zwischen technologischem Fortschritt und der Achtung vor den Grenzen des Menschlichen. Die Weisheit vergangener Zeiten, festgehalten in Mythen wie dem Prometheus oder dem Fall aus dem Paradies, erinnert uns daran, dass Übermut vor Grenzen und Maß uns teuer zu stehen kommen kann. Im alltäglichen Umgang mit KI bedeutet dies, nicht nur ihre Möglichkeiten zu feiern, sondern sich auch kritisch mit ihren Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Miteinander auseinanderzusetzen.
Letztlich sind wir alle, bewusst oder unbewusst, Victor Frankenstein in einem neuen Zeitalter. Wir tragen die Verantwortung, unsere technologischen Schöpfungen mit Umsicht und Weitsicht zu formen und zugleich die komplexen, vielschichtigen Facetten des Menschseins zu bewahren. Nur so kann unser Traum von einer besseren Welt durch künstliche Intelligenz nicht zu einem Alptraum werden, sondern sich in eine ausgewogene Realität verwandeln, die Menschlichkeit trotz aller Innovationen bewahrt.