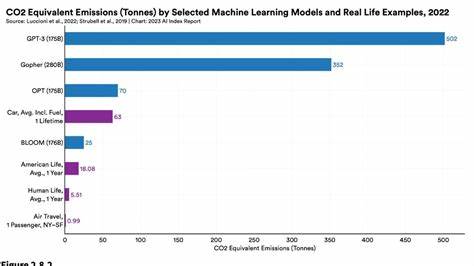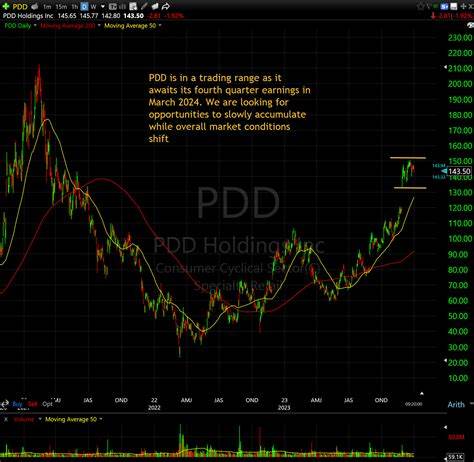Die Suche nach einer sauberen und nahezu unerschöpflichen Energiequelle steht im Zentrum der wissenschaftlichen Forschung des 21. Jahrhunderts. Einer der vielversprechendsten Ansätze ist die Kernfusion, der Prozess, der die Sonne und andere Sterne antreibt. Nach Jahrzehnten der Entwicklung steht der internationale Fusionsreaktor ITER nun an der Schwelle, einen entscheidenden Meilenstein zu erreichen. Das Herzstück des Reaktors, der sogenannte Zentralspule – der leistungsstärkste Magnet der Welt – ist endlich fertiggestellt und bereit für seine Montage.
Dieses Ereignis markiert einen bedeutenden Fortschritt in dem weltweit größten Projekt zur Erforschung der Kernfusion. Der ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) ist ein Beispielfall für internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit. Mehr als 35 Länder beteiligen sich an diesem ambitionierten Vorhaben mit dem Ziel, die Energie der Sonne auf die Erde zu bringen und so eine neue, nachhaltige Energiequelle zu erschließen. Das Projekt dauert mittlerweile fast 40 Jahre und hat sich zu einer der komplexesten Ingenieursleistungen der Menschheit entwickelt. Ein zentraler Punkt dabei ist die Fähigkeit, unter extremen Bedingungen Wasserstoffisotope zu verschmelzen und dadurch Energie freizusetzen.
Der Zentralspule kommt hierbei eine entscheidende Rolle zu. Dieser Magnet wiegt etwa 3000 Tonnen und ist das stärkste seiner Art weltweit. Seine Hauptfunktion besteht darin, das extrem heiße Plasma – mit Temperaturen von bis zu 150 Millionen Grad Celsius, also etwa zehnmal heißer als die Sonne – einzuschließen und zu stabilisieren. Ohne diese magnetische Einschließung könnte das Plasma mit seinen ungeheuren Temperaturen das Material des Reaktors zerstören. Die Entwicklung und der Bau des Zentralspule stellen eine gewaltige technische Herausforderung dar.
Das Bauteil selbst besteht aus rund 9000 Einzelteilen, die von mehreren Zulieferern aus den USA gefertigt wurden. Die Montage erfolgt in Frankreich, wo der ITER-Reaktor entsteht. Der Magnet ist nicht nur mit seiner enormen Magnetfeldstärke beeindruckend, sondern auch mit einer Technologie, die ihn in einem speziellen Exoskelett hält. Dieses Gerüst spielt eine essenzielle Rolle, um den dichten Kräften und starken magnetischen Spannungen standzuhalten, die bei der Erzeugung und Aufrechterhaltung des Plasmaeinschlusses auftreten. Die Funktionsweise des ITER unterscheidet sich selbstverständlich von derjenigen der Sonne.
Dort wird Fusion durch enormen Gravitationsdruck und eine gigantische Masse ermöglicht. Auf der Erde fehlt diese Masse, weshalb wir auf extrem hohe Temperaturen und innovative magnetische Methoden angewiesen sind, um Wasserstoffisotope zum Verschmelzen zu bringen. ITER nutzt Deuterium und Tritium, zwei Wasserstoffisotope, die durch ihre nuklearen Eigenschaften besonders geeignet sind für die Fusion. Werden diese Isotope unter hohen Temperaturen und Druck angeregt, überwinden sie die elektromagnetische Abstoßung zwischen den positiv geladenen Kernen mithilfe von Quantenmechanismen wie dem Tunneleffekt und verschmelzen zu Helium-Kernen. Dabei wird eine enorme Energiemenge freigesetzt, die durch Einsteins berühmte Gleichung E=mc² erklärt wird.
Mit einer geplanten Energieausbeute von 500 Megawatt bei lediglich 50 Megawatt Energiezufuhr zeigt ITER das Potenzial eines zehnfachen Energiegewinns. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Machbarkeit der Kernfusion als praktikable Energiequelle zu belegen. Neben der enormen Hitze muss der Reaktor ebenfalls dafür sorgen, dass Teile des Systems sehr kalt gehalten werden – nahe dem absoluten Nullpunkt – um die supraleitenden Magnete funktionsfähig zu halten. Somit arbeitet der ITER unter extremsten Temperaturgefällen, was die Herausforderungen an Material und Technik noch erhöht. Die Fertigstellung des Zentralspuls ist ein historischer Moment für den Fortschritt der Kernfusionstechnologie.
Der Magnet ist eine Art unsichtbares Kraftfeld, das das heiße Plasma in Schach hält und für die nötigen Bedingungen sorgt, um einen kontrollierten Fusionsprozess einzuleiten. Ohne diese Technologie wären stabile und nachhaltige Fusionsreaktoren nicht möglich. Die Montage der Zentralspule am ITER-Standort in Südfrankreich wird in den kommenden Jahren stattfinden und läutet eine neue Phase der Inbetriebnahme ein. Trotz der Fortschritte gibt es noch einen langen Weg bis zur vollen Funktionsfähigkeit des Reaktors. Die erste Zündung des Plasmas erwartet man nicht vor 2035.
Bis dahin müssen viele technische Herausforderungen gemeistert werden. Es gilt, die Effizienz zu steigern, die Stabilität zu erhöhen und die Anlage in einen Dauerbetrieb zu bringen, der wirtschaftlich und sicher ist. Dennoch symbolisiert die Fertigstellung des Zentralseils einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung der langfristigen Vision, starres fossiles Brennmaterial zu ersetzen und den Klimawandel mit grüner, sauberer Energie zu bekämpfen. Darüber hinaus steht ITER für das Potenzial der weltweiten wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Die beteiligten Nationen bringen ihre Expertise zusammen, um eine gemeinsame Herausforderung zu meistern, die alle betrifft: eine nachhaltige und saubere Energiezukunft.
Die Technologie, die in ITER entwickelt wird, könnte die Energielandschaft fundamental verändern und den Weg ebnen für kommerzielle Fusionskraftwerke, die in der Lage sind, große Mengen Energie ohne CO2-Ausstoß zu erzeugen. Der Bau und Betrieb von ITER ist eine Geschichte der Innovation, Ausdauer und zukunftsgerichteter Wissenschaft. Trotz aller Komplexität bleibt die Hoffnung, dass ITER eines Tages die ersten Schritte zeigt, um das Versprechen der Kernfusion einzulösen – saubere, sichere und nahezu unerschöpfliche Energie für die Menschheit. Die Fertigstellung des Zentralspuls ist dabei nicht nur ein technischer Triumph, sondern auch ein Symbol für die Kraft menschlicher Zusammenarbeit und Vision. Für die Zukunft der Energieversorgung bedeutet dies, dass wir von den Sternen lernen können, um auf der Erde Herausforderungen wie Ressourcenknappheit und Klimawandel zu bewältigen.
ITER ist mehr als nur ein Reaktor: Es ist ein Leuchtturm der Hoffnung und ein Brückenschlag zwischen heutiger Forschung und der Energieversorgung von morgen. Die Welt sieht gespannt auf die kommenden Jahre, in denen diese Technologie weiter Gestalt annimmt und schrittweise das „Bottling of a Star“ Realität werden könnte.