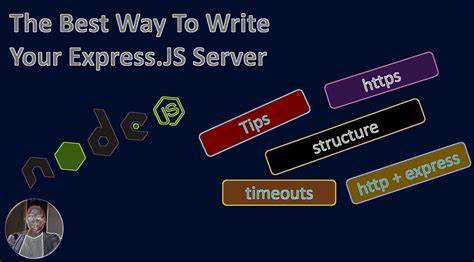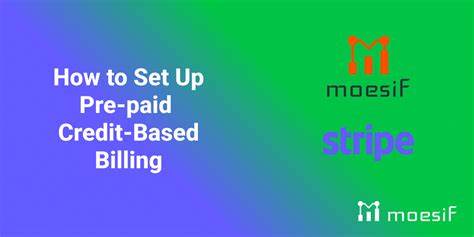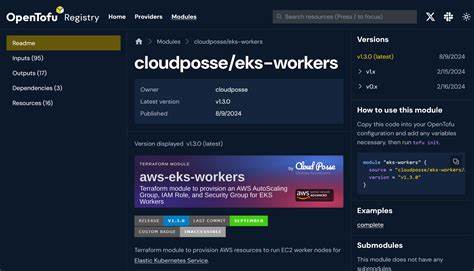Cockaigne ist ein Begriff, der tief im europäischen Mittelalter verwurzelt ist und eine Vorstellung von einem überschwänglichen Land der Fülle, des Wohlstands und der Müßiggänge verkörpert. Ursprünglich als Fluchtfantasie von Bauern und einfachen Leuten gedacht, symbolisiert Cockaigne eine Utopie freien Lebens, in der die allgegenwärtigen Entbehrungen des Alltags keine Rolle spielen. Im Gegensatz zur Mühsal des mittelalterlichen Lebens war Cockaigne ein Land, in dem Nahrung im Überfluss vorhanden war, Arbeit überflüssig erschien und soziale sowie religiöse Normen auf den Kopf gestellt wurden. Die Vision von Cockaigne, auch bekannt unter verschiedenen Namen wie Paese della Cuccagna oder Schlaraffenland, hat sich im Laufe der Jahrhunderte tief in Literatur, Kunst, Volksbräuchen und sogar modernen kulturellen Phänomenen verankert.Die Wurzeln des Begriffes Cockaigne lassen sich sprachlich auf das mittelalterliche französische Wort „cocaigne“ zurückführen, was so viel wie „Reich an Gütern“ oder „Land der Fülle“ bedeutet.
Interessanterweise ist die Namensherkunft mit einem kleinen süßen Kuchen verbunden, der bei Jahrmärkten an Kinder verkauft wurde. Dieses Bild des Genusses und der Leichtigkeit zog sich durch verschiedene Sprachen und Regionen Europas, so taucht die Vorstellung eines Cockaigne-ähnlichen Ortes im Italienischen als Paese della Cuccagna, im Niederländischen als Luilekkerland und im Deutschen als Schlaraffenland auf. In Spanien hat sich der Begriff País de Cucaña etabliert, der manchmal als „Narrenparadies“ übersetzt wird und auf ähnliche Vorstellung von leichtem Leben und Überfluss verweist. Die Idee fand sogar Eingang in Volksballaden und traditionelle Feste, beispielsweise mit dem beliebten Brauch des „Cockaigne Poles“, einem glitschigen Pfahl, an dem Preise befestigt sind, die mutige Teilnehmer bei Festen zu erlangen versuchen.In der mittelalterlichen Literatur wurde Cockaigne oft in Gedichten und Liedern dargestellt, die Erwachsenen und Kindern gleichermaßen vom Land des ewigen Genusses und der faulen Freude erzählten.
Diese Werke kamen häufig in Goliardenversen vor – einer speziellen Form des mittelalterlichen Trink- und Spottliedes, deren Themen oft die Absurditäten des klösterlichen Lebens aufs Korn nahmen. In diesen Gedichten verkehrt sich alles – die sozialen Ordnungen werden auf den Kopf gestellt, Mönche schlagen ihre Äbte, Nonnen vergnügen sich unbekümmert, und der Himmel regnet Käse. Der Verfasser George Ellis brachte im 18. Jahrhundert ein berühmtes französisches Gedicht über Cockaigne zu Gehör, das die Straßen aus Zucker und Häuser aus Gebäck beschreibt und bei dem alle Dinge sorglos frei erhältlich sind. Dies zeigt, wie die Vorstellung von Cockaigne als eine Art Parodie oder Überzeichnung weltlicher Sehnsüchte nach Genuss und Freiheit verstanden wurde.
Das Konzept hat Künstler aller Disziplinen inspiriert. Der berühmte Maler Pieter Bruegel der Ältere stellte Cockaigne 1567 unter dem Titel „Luilekkerland“ in einem Ölgemälde dar, das die Welt als nahrhaftes Schlaraffenland voller Faulheit und Überfluss beschreibt. Viele Details im Bild rufen eine Mischung aus Humor, Satire und verlockender Vorstellungskraft hervor, die das Publikum seit Jahrhunderten fasziniert. Auch in der Musik findet sich Cockaigne wieder – Edward Elgar komponierte 1901 mit „Cockaigne (In London Town)“ eine Konzert-Ouvertüre, die die pulsierende Lebendigkeit Londons zelebriert und den Begriff auf moderne urbane Verhältnisse adaptierte. Zudem ist Cockaigne in traditionellen Liedern wie „The Big Rock Candy Mountains“ enthalten, die immer wieder das Bild eines gelobten Landes mit weichen Eiern, wolkenähnlichen Zigarettenbäumen und warmem Wetter beschwören.
Neben Kunst und Literatur wurde Cockaigne auch im Alltag und in Volksbräuchen lebendig. Besonders der italienische und spanische Raum haben mit dem „Cuccagna“-Fest eine greifbare Tradition erhalten, bei der ein geglätteter Pfahl bestiegen werden muss, um Preise zu gewinnen. Dieses Element der fröhlichen Gemeinschaft erinnert an die Lust am Überfluss und die spielerische Überwindung von Schwierigkeiten, die sich perfekt mit der Ideologie von Cockaigne verbinden lässt. In einigen Orten tragen sogar Ortschaften den Namen Cockaigne oder Variationen davon, sei es in den Niederlanden, England oder Kanada, was die weite Verbreitung des Mythos zeigt.Die Bedeutung von Cockaigne geht weit über seine mittelalterlichen Ursprünge hinaus.
Im 19. und 20. Jahrhundert taucht das Motiv in verschiedensten literarischen Werken auf, etwa bei Baudelaire, der Cockaigne als poetisches Ideal zwischen Stille, Dekorum und Künstlichkeit betrachtet, oder in der Kinderliteratur, so ist das Land der Spielzeuge aus „Pinocchio“ eine Lokalisierung des Cockaigne-Motivs. Moderne Autoren wie James Branch Cabell und Clark Ashton Smith haben die Vorstellung ebenfalls variiert und in ihre Werke eingeflochten, wodurch Cockaigne als Synonym für den Wunsch nach einem sorglosen, genussvollen Leben seinen festen Platz in westlicher Kultur behielt.Philosophisch gesehen steht Cockaigne für eines der einfachsten aber auch ältesten utopischen Konzepte – eine Welt der grenzenlosen materiellen Fülle, in der Bedürfnisse und Sorgen verschwinden.