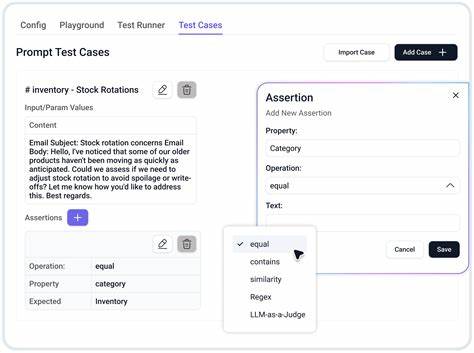Vor genau zwanzig Jahren wurde das Open Document Format, kurz ODF, offiziell als Standard anerkannt. Dieses Ereignis markierte einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der digitalen Dokumentenverarbeitung. ODF wurde ins Leben gerufen, um eine offene, herstellerunabhängige Alternative zu proprietären Office-Dokumentformaten zu schaffen, allen voran dem von Microsoft Office dominierten Markt. Doch trotz großer Hoffnungen und Engagement aus der Open-Source-Community hat sich das offene Format nicht so durchsetzen können, wie es sich seine Befürworter vorgestellt haben. Dieses Jubiläum bietet Anlass, die Geschichte, Bedeutung und die Herausforderungen des ODF zu reflektieren und die Frage zu stellen, warum Microsoft Office weiterhin das Büroformat der Wahl bleibt.
Anfang der 2000er Jahre, als das Internet immer mehr in den Alltag der Verbraucher vordrang, gab es erhebliche Bedenken hinsichtlich der Dominanz von US-amerikanischen Unternehmen über wichtige Anwendungen und Datenformate. Microsoft Office war zu jener Zeit das Synonym für Bürosoftware. Wer eine Word- oder Excel-Datei öffnen wollte, benötigte zwangsläufig eine Lizenz für die entsprechende Software. In diesem Umfeld trat Sun Microsystems auf den Plan, damals ein Schwergewicht im Bereich Serversoftware und Netzwerktechnologien, das OpenOffice als freie Office-Suite förderte. OpenOffice basierte auf dem Code von StarOffice, das Sun nach der Übernahme des deutschen Unternehmens Star Division im Jahr 1999 übernommen hatte.
Sun setzte auf die Extensible Markup Language (XML), um Dokumente in einem offenen, maschinenlesbaren Format zu strukturieren. Ziel war es, auf dieser Basis einen allgemein gültigen Standard für Office-Dokumente zu schaffen und somit den bisher geschlossenen Ökosystemen entgegenzuwirken. Die Idee war revolutionär: Statt jedes Programm mit einem eigenen Dateisystem auszustatten, sollte ein offenes, erweiterbares Format entstehen, das vielfältige Anwendungen und Plattformen unterstützt. 2002 reichte Sun die Spezifikation beim Organisation für die Förderung von strukturierten Information Standards (OASIS) ein. Dort wurde der Vorschlag nicht einfach übernommen, sondern über mehrere Jahre intensiv diskutiert, überarbeitet und verfeinert.
Am 1. Mai 2005 schließlich wurde das ODF offiziell als Standard anerkannt. Trotz dieser offiziellen Anerkennung und Unterstützung aus vielen Ländern und Organisationen blieb die praktische Akzeptanz begrenzt. Microsoft reagierte auf das Aufkommen von ODF mit einer eigenen Antwort: Office Open XML. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein XML-basiertes Format, das mit Microsoft Office 2007 eingeführt wurde und die bisherigen proprietären binären Formate ablöste.
Dieses Format wurde von Ecma International standardisiert, einer anderen Organisation für technische Standards. Durch diese „Zwei-Fronten-Strategie“ entstand eine Situation, in der die Office-Welt geteilt blieb. Microsoft Office beherrscht weiterhin den Großteil des Marktes, und obwohl moderne Office-Versionen ODF-Dateien lesen und schreiben können, sorgen gelegentliche Kompatibilitätsprobleme und Formatverluste dafür, dass viele Nutzer lieber an ihrem gewohnten Format festhalten. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind weitreichend. Im IT-Bereich symbolisiert ODF mehr als nur eine technische Spezifikation.
Es steht für Freiheit in der Softwarewahl, für Interoperabilität und für den Schutz der Nutzer vor den Einschränkungen proprietärer Ökosysteme. Viele öffentliche Institutionen weltweit haben den Standard deshalb akzeptiert. So verpflichtete sich die britische Regierung 2014 zur Nutzung von ODF für den Austausch und die Zusammenarbeit von Dokumenten, während die Europäische Kommission die Empfehlung aussprach, ODF für die Kommunikation mit Bürgern und Behörden zu verwenden. NATO hat ODF bereits 2008 als verpflichtenden Standard innerhalb ihrer Interoperabilitätsprofile verankert. Auch Länder wie Indien, Südafrika oder Brasilien setzen auf ODF, um Unabhängigkeit von großen Softwarekonzernen zu wahren und langfristige Verfügbarkeit von Daten zu garantieren.
Trotz dieser offiziellen Anerkennungen ist es die private Wirtschaft und der Großteil der Verbraucher, die Microsoft Office weiterhin als Standard wählen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum einen ist Microsoft Office über Jahrzehnte als Marktführer gewachsen und die meisten Unternehmen und Anwender nutzen es aus Gewohnheit und wegen der umfassenden Funktionen. Hinzu kommen Kompatibilitätsbedenken und die Tatsache, dass viele Drittanbieter-Lösungen auf dem Microsoft-Format aufbauen oder optimiert sind. Das Open-Source-Projekt LibreOffice, gesteuert von der Document Foundation, wurde als Abspaltung von OpenOffice geboren, nachdem Oracle, das Sun Microsystems übernommen hatte, das Interesse an der Weiterentwicklung von OpenOffice verloren hatte. LibreOffice ist initiiert worden, damit die Idee eines freien Office-Pakets lebendig bleibt und weiterentwickelt wird.
Es unterstützt ODF umfassend, kämpft jedoch ebenfalls mit denselben Schwierigkeiten bei der Verbreitung und Akzeptanz. Viele Nutzer, die auf lizenzfreie oder kostengünstige Lösungen setzen wollen, wählen LibreOffice und somit das offene Format, dennoch bleibt der Anteil der Microsoft-Dokumente ungebrochen dominant. Experten und Befürworter von ODF sehen das Format nicht nur als Alternative zu Microsofts Produkten, sondern als wichtige Grundlage für Datensouveränität und digitale Unabhängigkeit. In Zeiten wachsender technischer Abhängigkeiten und zunehmenden Datenschutzbedenken gewinnt die offene Dokumentation von Dateiformaten zusätzliche Bedeutung. Die Möglichkeit, Daten ohne Einschränkungen auszutauschen und auch im Fall von Unternehmenswechseln oder Softwareänderungen weiter verwenden zu können, ist ein unschätzbarer Vorteil.
Die Zukunft von ODF hängt stark von politischen Entscheidungen, technischer Weiterentwicklung und gesellschaftlichem Bewusstsein ab. Wenn offene Standards weiter von Regierungen und internationalen Organisationen bevorzugt und gefördert werden, könnte sich die Bedeutung von ODF schrittweise erhöhen. Neue Herausforderungen wie die Einbindung in Cloud-Anwendungen, Echtzeit-Zusammenarbeit und KI-gestützte Dokumentenverarbeitung werden ebenso entscheiden, ob ODF relevant bleibt oder von neueren Technologien verdrängt wird. Microsoft Office seinerseits passt sich permanent an die veränderten Bedürfnisse des Marktes an, integriert zunehmend Cloud-Diensleistungen und künstliche Intelligenz und schafft so für viele Nutzer weiterhin einen attraktiven Mehrwert. Dadurch bleibt seine Position auf dem Markt erst einmal gesichert.
Insgesamt zeigt der zwanzigjährige Rückblick auf das Open Document Format eine Geschichte von Ehrgeiz, technologischem Fortschritt und einer laufenden Auseinandersetzung um Freiheit versus Marktherrschaft. Die Idee einer offenen, herstellerneutralen Dokumentenwelt ist nach wie vor stark und gewinnt gerade im öffentlichen Sektor neuen Rückhalt. Gleichzeitig verdeutlicht der Erfolg von Microsoft Office, dass technologische Innovationen immer auch von Benutzerfreundlichkeit, Marketing und Ökosystemen abhängig sind. In einem zunehmend digitalisierten Zeitalter wird der Kampf um offene Formate weitergehen – und ODF bleibt ein zentrales Symbol für eine faire und offene Zukunft der digitalen Dokumentenerstellung und -bearbeitung.



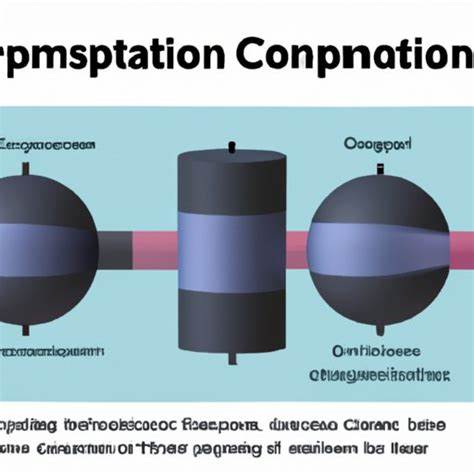

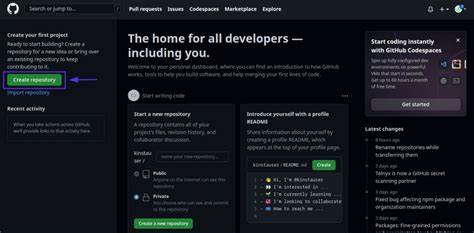
![Jeff Dean's talk at ETH Zurich in April 2025 on important trends in AI [video]](/images/76440C87-CE42-4647-B376-71F3D537DA19)