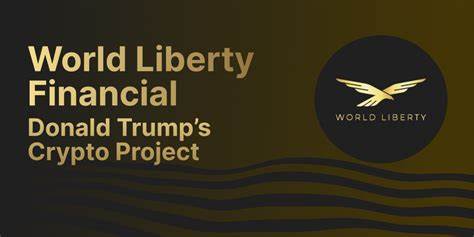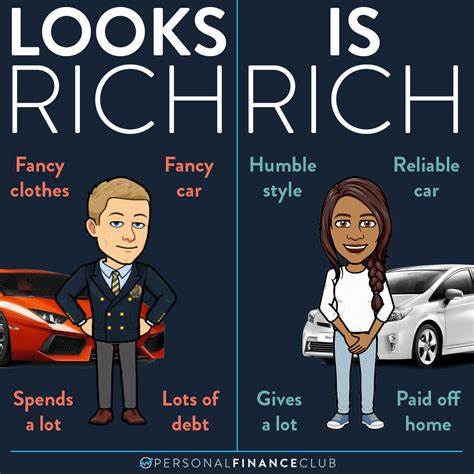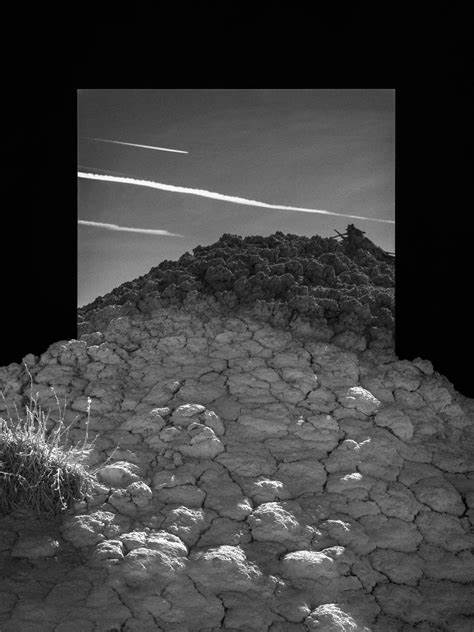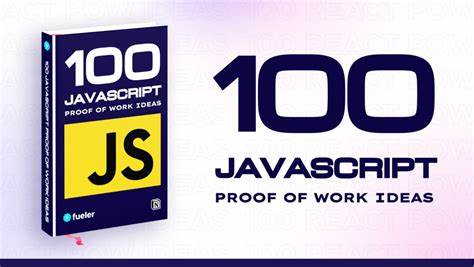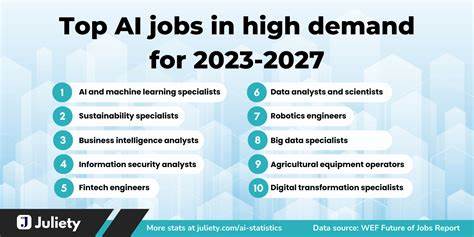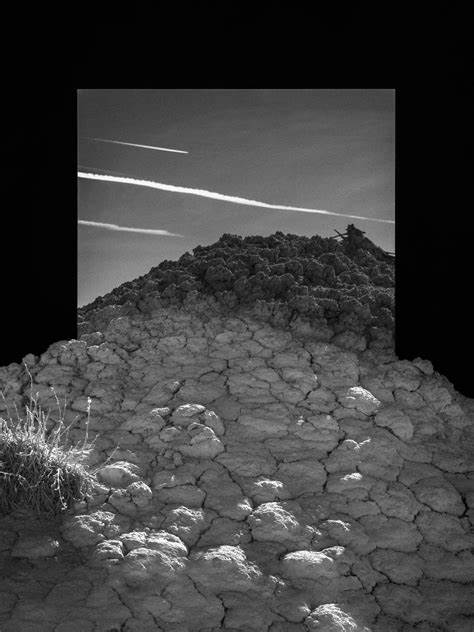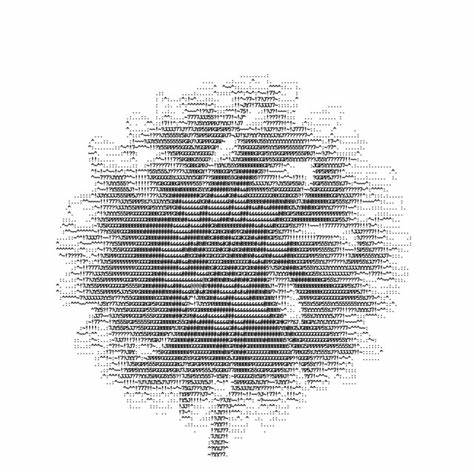Europa steht an einem kritischen Wendepunkt in der Entwicklung digitaler Zahlungsmittel. Während andere Regionen wie die USA versuchen, durch angepasste Gesetzgebungen und unterstützende Maßnahmen ihre Stellung im globalen Finanzmarkt zu stärken, behindern umfassende und komplexe Regulierungen in der EU den Fortschritt. Insbesondere die Einführung der Markets in Crypto-Assets-Verordnung, kurz MiCA, hat weitreichende Folgen für die Akzeptanz und Verbreitung von Stablecoins – digitalen Währungen, die an reale Währungen wie den Euro oder US-Dollar gebunden sind. Dabei bergen Stablecoins ein enormes Potenzial, um traditionelle Finanzprozesse grundlegend zu verändern und Europa als Vorreiter in der digitalen Geldrevolution zu positionieren. Doch stattdessen wirken die europäischen Regulierungen wie eine Bremse, die Innovationen erschwert und Unternehmen vor immense Hürden stellt.
Stablecoins werden oft als die „Killer-App“ der Fintech-Branche bezeichnet. Sie sind programmierbares Geld, das auf der Blockchain basiert und schnelle, kostengünstige und sichere Transaktionen über Grenzen hinweg ermöglicht. Für Verbraucher und Unternehmen eröffnen Stablecoins neue Möglichkeiten, etwa bei grenzüberschreitenden Überweisungen, die heute oft teuer und langsam sind. Ein Beispiel verdeutlicht dies anschaulich: Ein polnischer Arbeitnehmer, der in Frankreich tätig ist, kann durch Stablecoins seine Verdienste in Sekundenschnelle mit minimalen Gebühren an seine Familie in Polen senden. Die bisher üblichen Gebühren in Höhe von mehreren Euro pro Überweisung und Verzögerungen von mehreren Tagen entfallen dabei vollständig.
Neben der Zahlungsabwicklung profitieren auch Start-ups und Unternehmen von den Effizienzgewinnen. Sie können Kapital durch automatisierte Ausgabe von digitalen Wertpapieren beschaffen, was den Prozess schneller, transparenter und weniger bürokratisch macht als traditionelle Verfahren. Der Schlüssel zum Erfolg solcher digitalen Geldformen liegt in der rechtlichen Anerkennung und einem geeigneten regulatorischen Umfeld, das sowohl Sicherheit als auch Innovationsfreiheit gewährleistet. Europa hat bereits vor über zwei Jahrzehnten mit dem Elektronischen Geld-Gesetz (E-Geld-Richtlinie) einen wichtigen Schritt getan. Dieses Regelwerk erlaubt es Unternehmen wie PayPal, Revolut und Wise, E-Geld auszugeben und Millionen von Kunden zu bedienen.
Die Eigenschaft von E-Geld als digitale Geldform ist im Grunde ideal für die Umsetzung auf Blockchains. Problematisch wird die Situation jedoch mit der neuen MiCA-Verordnung, die explizit für das Regelwerk digitaler Vermögenswerte wie Stablecoins gilt. Während MiCA an sich ein modernes und wichtiges Regulierungsvorhaben ist, um den Rechtsrahmen für Krypto-Assets in der EU zu vereinheitlichen, verkomplizieren spezielle Anforderungen für auf Blockchain basierendes E-Geld die Umsetzung. Hierbei werden unter anderem Banken zu Gatekeepern gemacht, indem Stablecoin-Anbieter verpflichtet werden, mindestens 30 Prozent der Kundengelder über Bankeinlagen abzusichern. Anders als bei konventionellem E-Geld, das zu 100 Prozent durch hochwertige Anlageklassen wie Staatsanleihen gedeckt sein kann, zwingt MiCA die Emittenten dazu, Kapital an Banken zu binden und damit zusätzlichen Kosten und Risiken auszusetzen.
Das führt nicht nur zu einer Verteuerung des gesamten Ökosystems, sondern schafft auch eine Verschiebung im Wettbewerb. Banken werden durch diese Regulierung begünstigt, während innovative Fintechs, die digitale Geldformen ausgeben wollen, benachteiligt werden. Dies steht im klaren Widerspruch zu den Zielen der ursprünglichen E-Geld-Richtlinie, die ausdrücklich einen „fairen Wettbewerb“ zwischen Banken und Herausgebern elektronischen Geldes sicherstellen will. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die effektive Rolle der Banken selbst. Durch die Erfordernis, Gelder bei Banken zu hinterlegen, erhöhen sich Risiken, die durch die Bilanzsituation der Banken entstehen.
Dies widerspricht dem Ziel, sichere digitale Zahlungsmittel zu fördern und eliminiert teilweise die Vorteile von blockchainbasiertem Geld, das gerade durch Dezentralisierung und direkte Kontrollen punkten will. Im internationalen Vergleich zeigen sich auch politische Gegensätze. Während die EU mit MiCA die Hürden für Stablecoins anhebt, wird in den USA an einem umfassenden Stablecoin-Gesetz gearbeitet, das auf der europäischen E-Geld-Vorlage basiert, jedoch mit klaren Zielen zur Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des US-Dollars in der digitalen Welt. Zu diesen Maßnahmen gehört auch die Förderung einer digitalen Dollar-Dominanz durch geregelte, aber innovationsfreundliche Rahmenbedingungen. Der Unterschied zeigt, dass eine „fundamentale Änderung im Mindset“ nötig ist, wie es Mario Draghi, ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank, treffend formulierte.
Europa sollte jetzt die Gelegenheit nutzen, um regulatorische Ambitionen mit wirtschaftlicher Realität zu verbinden und sich als innovativer Fintech-Standort im globalen Maßstab zu etablieren. Wesentlich wäre, zunächst alle blockchain-spezifischen Anforderungen für E-Geld zu überdenken und jene bürokratischen Belastungen zu entfernen, die nicht zum Schutz der Nutzer beitragen, sondern den Marktzugang behindern. Weiter könnten europäische Institutionen – stichwort EZB – die Wettbewerbsbedingungen verbessern, indem sie Herausgebern von E-Geld direkten Zugang zu den Hauptzahlungssystemen und zu Sicherungsmechanismen der Zentralbanken ermöglichen. Dieser Schritt würde überflüssige Zwischenhändler und damit verbundene Gebühren aus dem Prozess entfernen und die Attraktivität von digitalen Währungen erheblich steigern. Berater des Internationalen Währungsfonds haben diese Idee bereits unterstützt und betonen die Bedeutung eines offenen und effizienten Finanzökosystems.
Die technologischen Möglichkeiten für eine digitale Euro-Variante sind vorhanden. Nicht zuletzt dank der Investitionen in zentrale digitale Währungen (CBDC) besteht die Chance, Europa im Bereich Blockchain-basiertes Geld voranzubringen. Doch solange regulatorische Barrieren den Zugang erschweren, können ambitionierte Projekte ihre Wirkung nicht voll entfalten. Die Konsequenzen einer weiteren Verzögerung sind gravierend. Europas Unternehmen und Verbraucher verlieren im globalen Wettlauf um digitale Finanzinnovationen an Boden.
Die Abhängigkeit von ausländischen Technologien und Stablecoin-Angeboten steigt, während heimische Unternehmer und Entwickler ins Hintertreffen geraten. Deshalb ist ein Umdenken auf politischer Ebene unverzichtbar, um die Rahmenbedingungen für digitale Zahlungsmittel zu verbessern, faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und die Risiken angemessen, aber nicht überzogen zu regulieren. Die Zukunft von Europas digitalem Geld hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, Bestandsregeln intelligenter anzupassen und den Innovationsgeist der Branche zu unterstützen. Nur so kann Europa sein Potenzial als führender Standort für digitale Finanzdienstleistungen ausschöpfen und seinen Bürgerinnen und Bürgern moderne, preiswerte und sichere Zahlungsoptionen anbieten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die MiCA-Verordnung trotz guter Ansätze zu tiefgreifenden Wettbewerbsverzerrungen führt, die den Fortschritt im Segment digitaler Währungen ausbremsen.
Die Regulierung muss praxisnah, technologieneutral und innovationsfreundlich gestaltet werden, um der Finanzbranche neue Impulse zu verleihen. Die Europäische Zentralbank und politische Entscheidungsträger sind gefordert, entschlossen zu handeln und Europa nicht länger mit unnötigem Regelwerk zu belasten. Andernfalls droht der Kontinent, beim wichtigsten Trend der kommenden Jahre – digitalem Geld und Blockchain-Finanztechnologien – den Anschluss zu verlieren und den wirtschaftlichen Nutzen weitgehend zu verschenken.