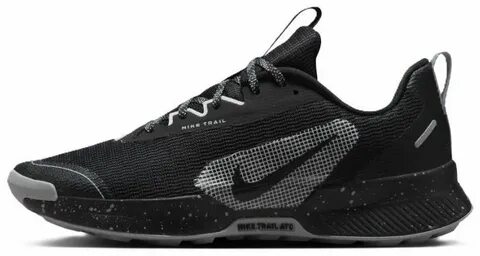Die urheberrechtliche Behandlung von fiktiven Charakteren ist eine komplexe und umstrittene Materie, insbesondere wenn es um nicht-menschliche Entitäten wie Fahrzeuge geht. Im Zentrum einer aktuellen Entscheidung des Ninth Circuit stand die Figur „Eleanor“, die aus mehreren Filmen des „Gone in Sixty Seconds“-Franchise bekannt ist. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass Autos mit diesem Namen letztlich nicht urheberrechtlich geschützt sind. Diese Entscheidung wirft bedeutsame Fragen auf, wie Charaktere im Sinne des Urheberrechts definiert und geschützt werden können und wo die Grenzen zwischen Idee und Ausdruck liegen. Der Fall Carroll Shelby Licensing v.
Halicki drehte sich um die Frage, ob „Eleanor“ als Charakter urheberrechtlichen Schutz verdient oder nur als Requisite im Film angesehen werden sollte. Dies ist ein wichtiger Gesichtspunkt, denn die Urheberrechtsgesetzgebung schützt grundsätzlich nur bestimmte Ausdrucksformen und nicht abstrakte Ideen. Auch ist die Freiheit der Meinungsäußerung grundgesetzlich verankert, was das „Monopolisieren“ von Ideen und Konzepten durch Urheberrechtseinschränkungen begrenzt. Traditionell kann ein Charakter dann als schutzwürdig gelten, wenn er physische und konzeptionelle Eigenschaften aufweist, die ihn klar erkennbar und unterscheidbar machen. genau diese Kriterien hat der Ninth Circuit in seinem Urteil angewandt.
Die Beurteilung stützt sich auf den sogenannten Towle-Test, der im Fall DC Comics v. Towle entwickelt wurde. Dieser sieht vor, dass ein Charakter bestimmte Anforderungen erfüllen muss, um Urheberrechtsschutz zu genießen: Er muss sowohl physische als auch konzeptuelle Qualitäten besitzen, er muss erkennbar und konsistent in seinen Eigenschaften sein und er muss sich durch eine besondere Individualität oder einen einzigartigen Ausdruck auszeichnen. Im Fall von Eleanor stellte das Gericht fest, dass zunächst die konzeptionellen Merkmale fehlen. Eleanor ist ein Auto, also ein lebloser Gegenstand ohne anthropomorphe Merkmale oder eine eigenständige Persönlichkeit.
Im Gegensatz zu Figuren, die Emotionen zeigen, Entscheidungen treffen oder direkt mit anderen Charakteren interagieren, bleibt Eleanor ein Fahrzeug ohne eigenes Handeln oder Sentimentalität. Damit erfüllte Eleanor nicht den ersten Teil des Towle-Tests. Auch in Bezug auf die zweite Anforderung, der Erkennbarkeit und Beständigkeit, konnte Eleanor nicht überzeugen. Über mehrere Filme und elf unterschiedliche Iterationen hinweg zeigte Eleanor eine stark wechselnde Erscheinung. Von gelb-schwarz lackierten Fastback Mustangs über graue Shelby GT-500 Modelle bis hin zu rostigen Autos ohne Lack variieren die physischen Attribute erheblich.
Diese stark divergierenden Darstellungen erschweren es, eine konstante, definierte Charakteridentität zu erkennen. Dazu kommen widersprüchliche Verhaltenszüge wie angebliche Widerstandsfähigkeit gegen Diebstahl oder Polizeiverfolgung, die mehr auf das fahrende Personal zurückgeführt werden können statt auf das Auto selbst. Auch in diesem Punkt scheiterte Eleanor als schutzwürdiger Charakter. Der dritte Gesichtspunkt des Tests verlangt nach einer besonderen Unterscheidungskraft und Einzigartigkeit des Charakters. Auch hier zeigte Eleanor keine herausstechenden Merkmale.
Das Design erinnerte eher an einen generischen Sportwagen als an ein unverwechselbares Fahrzeug mit eigenem Ausdruck. Der Name „Eleanor“ an sich ist ein allgemein verbreiteter Frauenname ohne speziell charakteristischen Bezug. Für die Filme war gerade die Normalität und Austauschbarkeit des Namens Teil des Drehbuchs und nicht ein Element, das ein schutzwürdiges Charakterprofil schafft. Darüber hinaus nahm das Gericht Bezug auf die früheren, teils widersprüchlichen Urteile zu „Eleanor“ und ähnlichen Fällen, etwa zum „Batmobile“. Im Fall DC Comics v.
Towle wurde das Batmobile zunächst als charakteristisches Element mit urheberrechtlichem Schutz anerkannt. Doch mit dem aktuellen Urteil wird diese Auffassung infrage gestellt. Während das Batmobile gewisse markante Merkmale aufweist, die es von anderen Fahrzeugen unterscheiden, fehlen diese bei Eleanor, was die Rechtsprechung in eine restriktivere Richtung bewegt. Das Urteil signalisiert eine Korrektur und Präzisierung dessen, was als „Charakter“ im urheberrechtlichen Sinne gelten kann, und setzt Grenzen für den übermäßigen Schutz von Ideen, die lediglich lose assoziiert oder kaum ausgeprägt sind. Diese Entscheidung hat weitreichende Folgen für Kreative und Rechteinhaber in Film, Literatur und anderen Medien.
Sie verdeutlicht, dass Urheberrechtsschutz nicht willkürlich auf beliebige Elemente ausgedehnt werden darf, sondern an klare, nachvollziehbare Kriterien geknüpft ist. Dies schützt zum einen den freien kreativen Austausch und verhindert übermäßige Monopolisierung von Ideen. Zum anderen ermöglicht es Produzenten, sich auf echte Innovationen und eigenständige Schöpfungen zu konzentrieren und nicht auf formlose oder zu generische Elemente, die kaum Schutz verdienen. Gleichzeitig werfen solche Urteile Fragen zur Abgrenzung zwischen Urheberrecht und anderen Schutzrechten wie Markenrecht auf. So bleibt die Möglichkeit, dass ein Name oder ein Design als Marke geschützt sein könnte, auch wenn es keinen Urheberrechtsschutz genießt – dies wird im Fall von „Eleanor“ und auch beim Batmobile diskutiert.
Das Markenrecht zielt vor allem darauf ab, Verbraucher vor Verwechslungen zu schützen und den Geschäftsauftritt zu regulieren, während das Urheberrecht Kreativität und künstlerische Ausdrucksformen sichert. Darüber hinaus ist der Fall ein Beispiel für die immer wieder auftretende Problematik, fiktionale Charaktere in einem Rechtsrahmen zu fassen, der ursprünglich nicht auf komplexe multimediale Schöpfungen ausgelegt war. Heutige Medienlandschaften fordern differenzierte Ansätze, um Innovation zu fördern und gleichzeitig legitime Schutzinteressen durchzusetzen. Gerade die Ambivalenz bei nicht-anthropomorphen Charakteren wie Autos oder Tieren ist eine Herausforderung für Gerichte und Gesetzgeber. Die Diskussion um die Urheberrechtlichkeit von „Eleanor“ zeigt, wie wichtig der sorgfältige Umgang mit juristischen Definitionen im Bereich des geistigen Eigentums ist.
Ein durchdachter und restriktiver Ansatz verhindert den Missbrauch von Urheberrechten zur Beschränkung von Wettbewerb und Kreativität. Er stellt zudem sicher, dass erst substanzielle und eigentümliche Charaktere die rechtliche Anerkennung erhalten, während bloße Requisiten oder austauschbare Elemente keine übermäßigen Rechte beanspruchen können. Abschließend steht fest, dass das Urteil des Ninth Circuit im Fall Eleanor eine Neuorientierung in der Bewertung von Charakteren aus Film und Medien darstellt. Es setzt Maßstäbe und gibt klare Signale dafür, wann und wie fiktionale Figuren als schutzfähig gelten können. Für Künstler und Rechteinhaber bietet es eine wichtige Orientierung, die kreative Freiheit wahrt und zugleich berechtigte Schutzansprüche respektiert.
Zugleich unterstreicht die Entscheidung die Bedeutung des Abwägens zwischen künstlerischem Ausdruck und dem Schutz von Ideen, was für die Weiterentwicklung von Urheberrechtsprinzipien essenziell bleibt.